Außergewöhnliche und extreme Wetterereignisse in Mitteleuropa über die letzten 2000 Jahre
sind durch historische Chroniken, naturwissenschaftliche Rekonstruktionen (z. B. Dendrochronologie) und moderne Wetteraufzeichnungen gut dokumentiert. Diese ungewöhnlichen Wetter-Ereignisse umfassen extreme Hitzeperioden, Dürren, kalte Winter, starke Schneefälle, Sturmfluten und andere Wetteranomalien, die oft erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen hatten. Im Folgenden stelle ich eine detaillierte und chronologisch geordnete Zusammenstellung solcher extremen Wetterereignisse zusammen, auf Grundlage von verfügbaren Quellen.
Zusätzlich sind einige der markantesten historischen Ereignisse in Europa der letzten 2000 Jahre mit aufgeführt, bei denen das Wetter oder die Witterungsbedingungen zwar nicht unbedingt extrem waren, aber einen maßgeblichen Einfluss auf den weiteren historischen Verlauf hatten. Sie ist eine Ergänzung oder Vertiefung der Seite Historie und Gesellschaft, auf der die wichtigsten historischen Ereignisse in Mitteleuropa zu Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Technologie, Religion und Kultur kompakt skizziert sind.
Die Liste ist nicht vollständig und trotz sorgfältiger Recherche nicht gesichert fehlerfrei, deckt aber markante Ereignisse ab, die in historischen und wissenschaftlichen Aufzeichnungen hervorgehoben werden. Hier gibt es die Klimahistorie der Erde mit Schwerpunkt auf den Grad der Vereisung der Erde.

Video-Zusammenfassung dieser Chronik
Ein Podcast über die Highlights dieser Chronik mit den extremsten Wetterereignissen in Mitteleuropa
(Podcast-Kanal Natur und Gesellschaft)
Wichtige Hinweise zur Datenlage zu außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa
- Quellen: Historische Aufzeichnungen vor 1500 sind oft lückenhaft und basieren auf Chroniken, die subjektiv gefärbt sein können. Ab dem 16. Jahrhundert verbessern sich die Daten durch systematischere Wetterbeobachtungen. Ab dem 19. Jahrhundert liefern instrumentelle Messungen präzisere Informationen.
- Kalender: Daten vor Oktober 1582 beziehen sich auf den julianischen Kalender, danach auf den gregorianischen Kalender. Die Einführung des gregorianischen Kaleners erfolgte in verschiedenen Ländern zu unterschiedlichen Zeiten (z. B. 1582 in katholischen Ländern, später in protestantischen Regionen wie Deutschland 1700). Dies könnte zu Unklarheiten bei der genauen Datierung von Ereignissen führen, insbesondere wenn Quellen aus verschiedenen Regionen verglichen werden.
- Klimakontext: Die letzten 2000 Jahre umfassen Perioden wie das Römische Klimaoptimum (ca. 250 v. Chr. – 400 n. Chr.), das Mittelalterliche Klimaoptimum (ca. 950–1250), die Kleine Eiszeit (ca. 1300–1850) und die moderne Erwärmung (seit ca. 1850), die das Auftreten von Extremereignissen beeinflussten.
- Bilder: Viele historische Bilder auf dieser Seite wurden mit KI erstellt und sind keine authentischen Abbildungen, sondern Symbolbilder. Sie sind jeweils am Wasserzeichen, z.B. bei Grok (XAI) zu erkennen. Aktuelle Bilder ab 2010 sind selbstproduziert.
- Links: Einige der Verlinkungen können Affiliate-Links enthalten. Dadurch entstehen Nutzern weder überdurchschnittliche Preise noch andere Nachteile.
Erklärung der Temperaturkurve
- Römisches Klimaoptimum (ca. 250 v. Chr. – 400 n. Chr.): Temperaturwerte etwa 0,5 °C über dem 20. Jahrhundert, günstig für Landwirtschaft und Weinbau.
- Spätantike Kleine Eiszeit (Kernzeit 536–660): Abkühlung um 0,5 °C, ausgelöst durch Vulkanausbrüche (z. B. 536) und Sonneneinstrahlungsschwankungen.
- Mittelalterliches Klimaoptimum (ca. 950–1250): Erwärmung um 0,5 °C, ermöglichte Landwirtschaft in höheren Breiten (z. B. Weinbau in England).
- Kleine Eiszeit (ca. 1300–1850): Abkühlung um 0,5 bis 1 °C, mit Spitzen um 1450–1700 (Maunder-Minimum). Markante Kälteextreme wie die Winter 1607/08, 1708/09 und 1739/40.
- Sommer 1540: Obwohl das Jahresmittel kälter war, zeigt der Punkt den extrem heißen Sommer (lokal +5–7 °C über Normal).
- Winter 1962/63: Ein Kälteeinbruch, aber bereits im Kontext der modernen Erwärmung.
- Moderne Erwärmung (seit 1850): Anstieg auf etwa +1 °C über dem Mittel des 20. Jahrhunderts bis 2025.
Mehr dazu auf der Seite Klima und Klimawandel.
Chronologische Zusammenstellung der Extremwetterereignisse
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa vor dem Jahr 1000
-
250 v. Chr. bis 400 n. Chr.: Römische Warmzeit. Hannibal überquerte mit seinen Elefanten die Alpen im Herbst des Jahres 218 v. Chr.
während des Zweiten Punischen Krieges. Die genaue Zeit wird oft auf September oder Oktober datiert. Hannibals Ziel war es, Rom direkt anzugreifen, um die römische Vorherrschaft im westlichen Mittelmeerraum zu brechen. Nachdem Karthago im Ersten Punischen Krieg (264–241 v. Chr.) Sizilien und Sardinien an Rom verloren hatte, suchte Hannibal eine entscheidende Offensive. Statt auf dem Seeweg anzugreifen, wo die römische Flotte überlegen war, wählte er den riskanten Landweg über die Alpen, um die Römer zu überraschen und ihre Verbündeten in Norditalien (z. B. gallische Stämme) für sich zu gewinnen.
Hannibals Zeit fällt in die sogenannte Römische Warmzeit, eine Periode mit vergleichsweise mildem Klima im Mittelmeerraum und in Mitteleuropa. Studien zur Klimarekonstruktion (z. B. durch Pollenanalysen, Gletscherrückzugsdaten und Baumringe) deuten darauf hin, dass:
Die Temperaturwerte in Europa damals etwas wärmer waren als in späteren Jahrhunderten (z. B. während der Kaltphase der Völkerwanderungszeit).
Die Alpen in mittleren und tieferen Lagen und während des Spätsommers/Herbstes oft schneeärmer waren als heute, da die Gletscher kleiner waren und die Schneegrenze höher lag.
Trotz dieser allgemein milderen Bedingungen war der Herbst in den Alpen (besonders in höheren Pässen wie dem Col de la Traversette, ca. 2.950 m) immer noch von niedrigen Temperaturwerte, Schnee und unbeständigem Wetter geprägt. Antike Quellen wie Polybios und Livius erwähnen Schnee, Eis und kalte Winde, was darauf hindeutet, dass die höheren Lagen nicht völlig schneefrei waren, auch wenn die Schnee- und Eisdecke wahrscheinlich dünner war als in kälteren Epoche.
Hannibal und seine Elefanten konnten die Alpen nur wegen der damals günstigen klimatischen Bedingungen überqueren, mit eher wenig Schnee und weit zurückgezogenen Gletschern. -
9 n. Chr.: Schlacht im Teutoburger Wald.
Diese Schlacht zwischen germanischen Stämmen unter Arminius und römischen Legionen unter Varus ist ein frühes Beispiel für den Einfluss des Wetters. Dauerregen und schlammiges Gelände behinderten die römischen Truppen erheblich, was ihre Mobilität einschränkte und sie anfälliger für Hinterhalte machte. Die Germanen nutzten diese Bedingungen, um die Römer in einem Waldgebiet zu besiegen, was zur chaotischen Niederlage und dem Rückzug der Römer führte. Die Niederlage stoppte die römische Expansion östlich des Rheins und hatte langfristige geopolitische Folgen. Mehr zur Schlacht im Teutoburger Wald.

-
58/59: Vermutlich außerst strenger Winter in Mittel- und Südeuropa.
-
246: Vermutlich sehr heißer Sommer, aber nur dünne Datenlage.
-
364–366 n. Chr.: Abfolge schwerer Sommerdürren,
die zu prolongierten Ernteausfällen und Nahrungsmittelknappheit führten und zur „Barbarischen Verschwörung“ von 367 n. Chr. beitrugen, einem katastrophalen militärischen Rückschlag für das Römische Britannien. Diese Dürren sind durch Baumringdaten und historische Berichte belegt. Neben 993 ein Kandidat für den Jahrtausendsommer.
-
406/07 (Spätantike): Extrem kalter Winter.
Dieser Winter ist berühmt, da der Rhein vollständig zufror, was den Germanenstämmen ermöglichte, die römische Grenze zu überschreiten.
Der Winter 406/407 n. Chr. gilt als einer der kältesten in der Spätantike in Mitteleuropa und war geprägt von anhaltenden Frostperioden, die zu extremen Witterungsbedingungen führten. Historische Quellen beschreiben ihn als ungewöhnlich hart, mit Temperaturen, die den Rhein – einen der breitesten und schnell fließenden Flüsse Europas – vollständig zufrieren ließen. Dies war ein rares Ereignis, da der Rhein normalerweise aufgrund seiner Strömung und Breite (bis zu 500 Meter) nur teilweise oder gar nicht einfriert.Der Frost setzte wahrscheinlich im späten Herbst 406 ein und hielt bis in den Frühling 407 an, mit einer besonders intensiven Kältewelle um den Jahreswechsel. In Mitteleuropa, insbesondere im Rheinland, dem Elsass und angrenzenden Regionen wie dem heutigen Deutschland, Frankreich und der Schweiz, führte dies zu einer regionalen Abkühlung, die möglicherweise mit natürlichen Schwankungen wie Sonnenfleckenminima zusammenhing – ähnlich wie bei späteren kalten Wintern in der Neuzeit. Berichte deuten auf Schnee- und Eisdecken hin, die den Boden monatelang unpassierbar machten, Flüsse und Seen vollständig einfrieren ließen und die Landwirtschaft sowie den Handel lahmlegten. Der Rhein fror so dick zu, dass er als stabile Brücke für große Menschenmengen, Tiere und Wagen diente, was in antiken Quellen wie denen des Prosper von Aquitanien oder Orosius hervorgehoben wird. Die Strenge wird oft mit anderen historischen Kälteperioden verglichen, wie dem „Großen Frost“ von 1709, bei dem Temperaturen bis -15 °C gemessen wurden, obwohl exakte Messungen für 406/407 fehlen. Es handelte sich um ein lokales Phänomen, das Mitteleuropa stärker traf als südlichere Regionen, und es verstärkte bestehende Migrationsdrücke durch Ernteausfälle und Hungersnöte.
Moderne Analysen sehen in diesem Winter einen Auslöser für breitere klimatische Veränderungen in der Spätantike, die den Übergang zur Völkerwanderungszeit beeinflussten. Daher war die Kälte extrem, wahrscheinlich durch vulkanische Aktivitäten verstärkt, die zu einer globalen Abkühlung führten. Mehr im Artikel: Kälteste und strengste Winter der letzten 2000 Jahre.
-
500 bis 700: Spätantike Kleine Eiszeit (SAKE).
Die Kaltphase der Völkerwanderungszeit war eine deutliche Abkühlung nach der Römischen Warmzeit. Klimarekonstruktionen (z. B. durch Baumringe, Eisbohrkerne und Pollenanalysen) zeigen folgende Merkmale:
-
Temperaturabfall: In Europa sanken die Durchschnittstemperaturen um etwa 1–2 °C im Vergleich zur Römischen Warmzeit. Sommer waren kühler und kürzer, Winter länger und strenger.
-
Niederschläge: Es gab eine Zunahme von Niederschlägen, oft in Form von Regen oder Schnee, was zu feuchteren Bedingungen führte. Dies begünstigte Überschwemmungen und machte die Landwirtschaft schwieriger.
-
Gletschervorstöße: In den Alpen und anderen Gebirgen wuchsen Gletscher, und die Schneegrenze sank. Pässe, die in der Römischen Warmzeit noch begehbar waren, wurden schwieriger.
-
Vegetationsveränderungen: Kältere Temperaturwerte führten zu einem Rückgang wärmeliebender Pflanzen (z. B. Weinreben) in nördlichen Regionen und zu einer Ausbreitung von kälteverträglicheren Arten.
Die klimatischen Veränderungen hatten tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Folgen: -
Migrationen: Kälteres Klima und Ernteausfälle drängten viele Stämme (z. B. Goten, Franken, Hunnen) dazu, in fruchtbarere Regionen wie das Römische Reich zu ziehen, was die Völkerwanderungen verstärkte.
-
Kollaps von Gesellschaften: Die Abkühlung schwächte das ohnehin krisengeplagte Weströmische Reich (476 n. Chr. fiel es endgültig) und erschwerte die Versorgung der Bevölkerung.
-
Krankheiten: Die Justinianische Pest (541–544 n. Chr.) wurde durch die geschwächte Bevölkerung und den Handel entlang der neuen Migrationsrouten begünstigt, was Millionen Todesfälle verursachte.
-
-
535/536: Der Winter 535/536 war eines der extremsten und folgenreichsten Wetterereignisse der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa und weltweit,
ausgelöst durch einen massiven Vulkanausbruch, der einen „Staubschleier“ verursachte. Er war in Mitteleuropa weniger intensiv in Bezug auf akute Kälte als die Winter 763/64 oder 1708/09, aber seine globalen Auswirkungen, die langfristige Abkühlung (LALIA) und die gesellschaftlichen Folgen (Hungersnöte, Justinianische Pest, Migrationen) machen ihn historisch einzigartig. Kein anderer Winter der letzten 2000 Jahre kombinierte eine solche globale Reichweite mit so tiefgreifenden sozioökonomischen und klimatischen Konsequenzen. Die massive Reduktion der Sonneneinstrahlung führte zu einer längerfristigen Abkühlung, die mehrere Jahre anhielt. Im modernen Kontext sind solche Ereignisse unwahrscheinlich, könnten aber durch zukünftige vulkanische Ereignisse wieder auftreten.
-
Sommer 536 (Spätantike Kleine Eiszeit):
Der Sommer 536 gilt als einer der kältesten in den letzten 2000 Jahren, ausgelöst durch einen massiven Vulkanausbruch (möglicherweise in Island oder Nordamerika), der Aerosole in die Atmosphäre schleuderte und die Sonneneinstrahlung blockierte. In Mitteleuropa (z. B. Schweiz, Süddeutschland) wurden Ernteausfälle dokumentiert, die eine Hungersnot einleiteten.
-
590: Sehr heißer und trockener Sommer.
Proxy-Daten (insbesondere Baumringe) und historische Berichte aus der Spätantike deuten auf einen sehr heißen und trockenen Sommer in Mitteleuropa hin. Chroniken aus dem Frühmittelalter beschreiben Dürren und Ernteausfälle in Regionen, die heute Süddeutschland, Frankreich und Norditalien umfassen. Klimarekonstruktionen aus Baumringen zeigen eine starke Temperaturanomalie (ca. 2–3 °C über dem Durchschnitt). Archäologische Funde deuten auf Wasserknappheit.
Der Sommer 590 könnte in seiner Intensität mit 1811 oder 1834 vergleichbar sein, aber weniger extrem als 1540. -
763/764 (Jahrtausendwinter):
Der Winter 763/64 wird in historischen Quellen als einer der extremsten Winter in Mitteleuropa beschrieben, oft als „Großer Winter“ oder „Jahrtausendwinter“ bezeichnet. Es gibt keine instrumentellen Wetteraufzeichnungen aus dieser Zeit, daher stammen die Informationen aus chronikalischen Berichten, die phänologische und physikalische Auswirkungen dokumentieren. Zu den wichtigsten Details gehören:
Extreme Kälte und lange Dauer: Der Winter begann vermutlich im Oktober 763 und erstreckte sich bis weit in den Frühling 764. Berichte beschreiben eine ungewöhnlich lange Frostperiode, die selbst in Regionen mit normalerweise mildem Klima extreme Auswirkungen hatte.
Zahlreiche Flüsse, darunter die Donau, Themse und sogar Teile der Ostsee, froren vollständig zu. Besonders bemerkenswert ist, dass die Ostsee so stark vereist war, dass sie begehbar wurde, was auf Temperaturwerte weit unter -20 °C hinweist. Selbst in südlicheren Regionen wie Norditalien (Padua) wurden ungewöhnlich hohe Schneedecken berichtet.
Das Schwarze Meer fror über 150 km vom Ufer entfernt zu einer Tiefe von ca. 14 m zu, was auf Temperaturen weit unter -10°C hindeutet.
Chroniken berichten von gefrierendem Wein in Fässern, was Temperaturwerte unter -15 °C bis -20 °C voraussetzt. In Danzig (heutiges Gdańsk) liefen Kinder noch nach Pfingsten (Mitte Mai 764) auf gefrorenen Gräben Schlittschuh, was auf eine außergewöhnlich lange Kälteperiode hinweist. (Eislaufen im Mai auf gefrorenen Gewässern – wie war das möglich?)
Hohe Sterberaten durch Kälte, Hungersnöte, Tiersterben und gestörte Transporte; Berichte aus Byzanz und Westeuropa sprechen von „endlosen“ Frostphasen. Es gibt zudem Hinweise auf Missernten und Hungersnöte im Folgejahr, da die Kälte die Landwirtschaft stark beeinträchtigte.
Der Winter 763/764 war vermutlich einer der extremsten Winter der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa, gemessen an seiner Dauer, geographischen Reichweite und den berichteten Auswirkungen (gefrorene Ostsee, Schlittschuhlaufen bis Mai). Nur die Jahrtausendwinter 1708/09, 1739/40 oder 1607/08 sind in seiner Intensität vergleichbar, waren aber besser dokumentiert und vermutlich etwas kürzer (1708/09). Andere kalte Winter wie 1962/63 oder 1076/77 waren ebenfalls extrem, erreichen aber nicht die außergewöhnliche Kombination aus Dauer und Reichweite von 763/64.

-
821/822: Sehr strenger Winter.
Historische Aufzeichnungen klassifizieren den Winter 821/822 als „severe“ oder „heavy winter“, was auf eine überdurchschnittliche Kälte hinweist. Speziell für Mitteleuropa (einschließlich Gebiete wie dem heutigen Deutschland, Österreich und Ungarn) gibt es Hinweise auf das Zufrieren der Donau, was ein klares Zeichen für anhaltende Frostperioden ist. Die Donau, die durch zentraleuropäische Regionen fließt, fror in dieser Zeit zu, was ein deutliches Indiz für extreme Kältewellen ist und den Verkehr sowie die Landwirtschaft beeinträchtigte. Solche Ereignisse wurden in der Antike und frühen Mittelalter oft mit militärischen oder wirtschaftlichen Konsequenzen in Verbindung gebracht, z. B. dass Armeen oder Händler den gefrorenen Fluss überqueren konnten.Der Winter fiel in die sogenannte „Medieval Warm Period“ (ca. 800–1300 n. Chr.), eine relativ milde Phase, in der strenge Winter dennoch vorkamen – oft durch vulkanische Aktivitäten oder atmosphärische Zirkulationsmuster ausgelöst.
Im Vergleich zu anderen Jahren dieser Epoche war 821/822 bemerkenswert, da er mit globalen Extremereignissen korreliert: Historische Records aus China berichten von extremen Eisereignissen in marginalen Meeren in genau diesem Winter, was auf eine breitere hemisphärische Abkühlung hindeuten könnte.
In Europa selbst werden ähnliche Bedingungen in nahen Jahren dokumentiert, z. B. 817/818 (schwere Schneefälle und gefrorene Seen in Irland und Britannien) oder 827 (Thames fror für neun Wochen zu), was auf eine regionale Kältewelle schließen lässt.
Auswirkungen: Anhaltender Frost führte zu gefrorenen Gewässern, was Ökosysteme störte. Die Donau-Eisführung deutet auf Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt über Wochen hin, vergleichbar mit modernen Kältewellen von -10 bis -20 °C in Mitteleuropa.
Gesellschaft und Wirtschaft: Wenig detaillierte Berichte, aber in analogen Wintern (z. B. 763/764) starben Menschen und Tiere, und es kam zu Hungersnöten durch verzögerte Ernten. Für 821/822 könnten ähnliche Impacts in Mitteleuropa angenommen werden, da der Donau-Frost den Transport behinderte.
Der Winter 821/822 rangiert schätzungsweise auf Platz 12–15 in einer Top-20-Liste der strengsten Winter in Mitteleuropa über die letzten 2000 Jahre. Er ist bemerkenswert für seine Zeit (Medieval Warm Period), aber überholt von den intensiveren Extremen der Little Ice Age (LIA, ca. 1300–1850), die bessere Dokumentation haben und stärkere Anomalien aufwiesen (bis -4 °C unter Präindustriellem). Frühere Winter wie 763/764 (Black Sea und Donau froren massiv, mit Schnee von 30 Fuß) waren potenziell strenger, da sie breitere Impacts hatten. -
859/60: Strenger Winter.
Der Winter 859/60 gehört zu den bemerkenswertesten Kälteereignissen der frühen mittelalterlichen Klimageschichte Mitteleuropas und wird in historischen Quellen als außergewöhnlich streng beschrieben. Er fällt in eine Zeit vor der Kleinen Eiszeit (ca. 1300–1850), in der extreme Wetterereignisse seltener, aber dennoch möglich waren. Die Informationen über diesen Winter stammen hauptsächlich aus mittelalterlichen Chroniken, Annalen und Proxydaten wie Baumringen, die auf eine signifikante Kälteperiode hinweisen.
Der Winter 859/60 war ein extrem kalter Winter in Mitteleuropa, gekennzeichnet durch gefrorene Flüsse (Rhein, Donau, Seine), starke Schneefälle und Hungersnöte, die weitreichende gesellschaftliche Folgen hatten. Er gehört wahrscheinlich zu den Top 20 der kältesten Winter der letzten 2000 Jahre, aber hinter 821/822 und damit auch hinter 1607/08, 1708/09, 406/07 und 763/64, aber vor 1572/73. Seine Besonderheit liegt in der Seltenheit eines solch extremen Winters in der wärmeren Klimaperiode des frühen Mittelalters. Im Vergleich zu 1572/73 war er vermutlich etwas intensiver und seltener, da er außerhalb der Kleinen Eiszeit auftrat. Für eine genauere Analyse wären detailliertere Proxydaten oder regionale Studien nötig, die jedoch für das 9. Jahrhundert begrenzt sind.
859/60 war vermutlich kälter als 874/75 und hatte eine größere geografische Reichweite (gefrorene Seine, Donau, Rhein). Die Hungersnöte und Sterblichkeit waren schwerwiegender, und die Chroniken legen mehr Gewicht auf die Katastrophe. -
874/75: Der Winter 874/875 in Mitteleuropa wird in historischen Quellen als außergewöhnlich streng beschrieben.
Laut Aufzeichnungen, etwa in den Annalen von Fulda, begann die Kälte bereits im November 874 und hielt bis in den Frühling 875 an. Flüsse wie der Rhein froren zu und den Transport sowie die Versorgung stark beeinträchtigte. Die Kälte führte zu Missernten, wodurch im Folgejahr Hungersnöte auftraten. Berichte erwähnen zudem, dass selbst in Regionen wie Norditalien, die normalerweise mildere Winter erlebten, Schnee und Frost auftraten. Es wird angenommen, dass eine starke Abkühlung durch vulkanische Aktivität – möglicherweise ein Ausbruch in Island oder Asien – Aerosole in die Atmosphäre schleuderte, die die Sonneneinstrahlung reduzierten und so zu einem globalen Temperaturabfall führten. Solche Ereignisse waren in der Mittelalterlichen Warmzeit (ca. 800–1300) selten, weshalb der Winter 874/875 besonders hervorstach.Im Vergleich zu anderen kalten Wintern der letzten 2000 Jahre fällt auf, dass der Winter 874/875 zwar extrem war, aber nicht die Intensität späterer „Jahrtausendwinter“ erreichte. Der Winter 763/764, der als einer der härtesten gilt, brachte in Mitteleuropa noch extremere Bedingungen: Berichte beschreiben, dass selbst die Adria teilweise zufror und in Konstantinopel (heutiges Istanbul) der Bosporus überquerbar war – ein Ereignis, das für das 8. Jahrhundert beispiellos ist.
Der Jahrtausendwinter 1708/1709 übertrifft jedoch beide in seiner dokumentierten Schwere. In diesem Winter froren selbst der Gardasee und Teile der Ostsee zu.
Der Winter 1962/1963, der kälteste des 20. Jahrhunderts in Deutschland, brachte Dauerfrost über drei Monate – allerdings war er regional weniger extrem als die genannten historischen Winter.
Einordnend lässt sich sagen, dass der Winter 874/875 in Mitteleuropa zwar zu den härtesten des 9. Jahrhunderts zählt, aber in seiner globalen Auswirkung und den dokumentierten Folgen hinter Ereignissen wie 763/764, 821/822 oder 1708/1709 zurückbleibt. Die Hauptursachen solcher Kältephasen waren oft vulkanische Aktivitäten und Schwankungen in der Sonnenaktivität, die in der Kleinen Eiszeit (ca. 1300–1850) häufiger auftraten. -
934/935: Extreme Kälte in Mittel- und Nordeuropa.
Es war zwar eine in Mitteleuropa bedeutende Kältephase, blieb jedoch in seiner globalen Wirkung hinter Ereignissen wie 763/764, 821/822 oder 1708/1709 zurück.
-
985/986: Wikinger-Expansion nach Grönland
Um 985/986 n. Chr.: Erik führte eine Flotte von etwa 25 Schiffen mit Siedlern nach Grönland, wo sie zwei Hauptsiedlungen gründeten: die Östliche Siedlung (Eystribyggð, im heutigen Südgrönland) und die kleinere Westliche Siedlung (Vestribyggð, weiter nördlich). Dies markiert den Beginn der norwegischen Kolonisierung Grönlands.
Das Klima in Grönland während der Wikingerzeit unterschied sich deutlich von den heutigen Bedingungen, war aber immer noch herausfordernd:
Während dieser Mittelalterlichen Warmzeit (ca. 950–1250 n. Chr.) war das Klima im Nordatlantik milder als heute, mit höheren Durchschnittstemperaturwerten (schätzungsweise um 1–2 °C wärmer in Südgrönland).
Die Fjorde in Südgrönland waren weitgehend eisfrei, und die Küstenregionen boten Grasland, das für die Viehzucht (Schafe, Ziegen, Rinder) geeignet war. Archäologische Funde zeigen, dass die Wikinger Getreide wie Gerste anbauten, wenn auch in begrenztem Umfang.
Die Meere rund um Grönland waren weniger von Packeis bedeckt, was die Seefahrt zwischen Grönland, Island und Norwegen erleichterte.
Dennoch war das Klima herausfordernd: Die Vegetationsperiode war kurz, und die Siedlungen waren stark von Viehzucht und Jagd abhängig.
Vergleich zum heutigen Klima:
Heute ist das Klima in Grönland kälter und rauer, da die Mittelalterliche Warmzeit von der Kleinen Eiszeit (ca. 1300–1850 n. Chr.) abgelöst wurde, die das Klima im Nordatlantik verschlechterte. Obwohl das aktuelle globale Klima sich erwärmt, bleibt Grönland größtenteils von Gletschern und Eis bedeckt, und die Landwirtschaft ist schwieriger als in der Wikingerzeit. Die Fjorde sind heute oft länger vereist, und die Vegetationsperiode ist kürzer. Moderne Landwirtschaft in Südgrönland (z. B. Kartoffelanbau) ist nur mit technologischer Unterstützung möglich. Mehr unter „Warum konnten die Wikinger im Hochmittelalter Grönland besiedeln?„
Die Wikinger-Expansion nach Grönland 985 konnte nur stattfinden, weil in der Hochmittelalterlichen Warmzeit die klimatischen Bedingungen günstiger waren – sogar noch im Vergleich zu heute. -
986: Sehr warmer Sommer, jedoch dünne Datenlage.
-
987: Außergewöhnliche Unwetter im Erzgebirge (Miriquidi).
Jäger und Durchreisende berichteten von starken Stürmen oder Niederschlägen in der Region, die in Chroniken der nahegelegenen Siedlungen (z. B. Meißen, Naumburg) festgehalten wurden. Die genaue Natur des Ereignisses ist unklar, da die Quellen spärlich sind.
-
992/93: Vermutlich sehr kalter Winter, aber nur geringe Quellenangaben
-
993: Vermutlich sehr heißer und trockener Sommer.
Vereinzelt wird sogar von einem Jahrtausendsommer und extremer Dürre berichtet. Historische Quellen aus dem Hochmittelalter berichten von einer schweren Dürre und Hitze in Mitteleuropa, insbesondere im heutigen Deutschland und Frankreich. Flüsse wie der Rhein hatten niedrige Pegelstände, und es gab Berichte über Hungersnöte.
Vermutlich ähnlich intensiv wie 1811, aber weniger gut dokumentiert als moderne Sommer wie 2003 oder 2022.
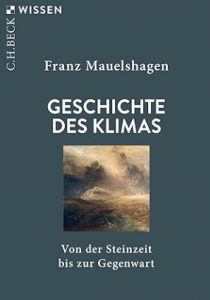
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 11. Jahrhundert
-
1010/11: Strenger Winter,
festgestellt aufgrund von von Chroniken und Proxy-Daten.
-
1012–1017: Mehrere Sturmfluten an der Nordseeküste,
insbesondere in den Jahren 1012, 1015, 1016 und 1017. Diese Ereignisse führten zu erheblichen Landverlusten, da die Küsten damals kaum durch Deiche geschützt waren. Der steigende Meeresspiegel seit dem Ende der Eiszeit verstärkte die Schäden.
-
1035: Heißer Sommer (Mittelalterliches Klimaoptimum),
Chroniken berichten von „unerträglicher Hitze“. Historische Berichte aus Süddeutschland und Frankreich beschreiben Hitzewellen, trockene Flüsse (z. B. Loire) und Ernteausfälle. Das Mittelalterliche Klimaoptimum war generell wärmer, aber 1035 sticht durch Berichte von Hitze und Dürre hervor mit Ernteausfällen, Hungersnöten, gesellschaftliche Unruhen.
-
1041: Eine weitere schwere Sturmflut an der Nordsee,
die zahlreiche Opfer forderte und Landflächen überflutete.
-
1057: Heißer Sommer.
Historische Quellen berichten von außergewöhnlich langen Hitzewellen. Weinlese in manchen Regionen bereits im Juli.
Chroniken nennen ihn den „Sommersommer“. -
1061: Sehr warmer Sommer,
jedoch nur wenig Daten verfügbar
-
1066: Sturmflut an der Nordseeküste,
die in Chroniken als besonders verheerend beschrieben wird. Sie fiel zeitlich mit der normannischen Eroberung Englands zusammen, was ihre historische Bedeutung erhöhte.
-
1072/73: Außergewöhnlich milder Winter.
In Mitteleuropa trieben Bäume bereits zu Neujahr aus, und Vögel hatten im Februar Junge – ein extrem ungewöhnliches Phänomen für diese Jahreszeit. Nur wenig detaillierte Daten.
-
1076/77: „Gang nach Canossa“ bei Schnee & Eis, strenger Winter.
Der Winter 1076/77 war einer der kältesten der Mittelalterzeit. Der Winter begann bereits Ende Oktober 1076 und hielt ununterbrochen bis Mitte April 1077 an. Temperaturwerte sanken in Mitteleuropa auf schätzungsweise −10 bis −15 °C, besonders im Januar 1077, als König Heinrich IV. seine Reise antrat. In den Alpen, die Heinrich überqueren musste, herrschten eisige Bedingungen mit starkem Frost. Mehr Hintergründe zum Gang nach Conossa auf Historie und Gesellschaft.
Der Winter war zudem extrem schneereich. Zeitgenössische Berichte sprechen von hohen Schneemengen in ganz Europa, insbesondere in den Alpen und Norditalien. Der Mont Cenis, den Heinrich überquerte, war durch Schnee und Eis nahezu unpassierbar, was die Reise gefährlich machte.
Alle europäischen Flüsse und Seen froren zu, darunter auch der Rhein und der Po in Norditalien. Die Kälte führte zu erheblichen Schäden in der Landwirtschaft, insbesondere im Weinbau, da viele Rebstöcke erfroren.
Die extreme Kälte und der Schnee verursachten erhebliche Probleme. In der Landwirtschaft kam es zu Ernteausfällen, die die Versorgungslage verschlechterten, und die Mobilität war stark eingeschränkt, was Heinrichs Reise zusätzlich erschwerte. Der Winter 1076/77 war kälter als moderne Winter wie 1962/63 oder 1978/79, aber milder als die Jahrtausendwinter 763/64, 1708/09 und 1739/40.

Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 12. Jahrhundert
-
1102: Berichte über eine starke Dürresituation
in Kombination eines sehr warmen Sommers.
-
1137: Extreme Trockenheit in West- und Mitteleuropa,
die Ernten stark beeinträchtigte.
-
1149/50: Jahrhundertwinter mit Kälte bis in den Mai.
Es kam zu Bienensterben sowie erheblichen Schäden an Getreide und Rebstöcken.Teilweise wurde der Handel eingestellt, weil Flüsse zufroren. Es gibt Erwähnungen von Ernteausfällen im Folgejahr, was auf eine Kombination aus spätem Frost und anhaltender Kälte schließen lässt.
-
1164 (16. Februar): Gewaltige Sturmflut an der Nordseeküste,
vermutlich die Zweite Marcellusflut, mit geschätzten über 100.000 Toten. Besonders betroffen waren die südwestlichen Nordseeküsten (heutiges Holland).
-
1185/86 (Jahrtausend-Mildwinter):
Möglicherweise der mildeste Winter in der europäischen Geschichte. In der Schweiz blühten Bäume im Januar, im Februar wuchsen haselnussgroße Äpfel, im Mai wurde geerntet, und im August gab es bereits Wein – ein extrem ungewöhnliches phänologisches Ereignis.
Zeitgenössische Aufzeichnungen berichten von Baumblüte im Januar, Vögeln, die im Januar brüteten, und Mädchen, die mit frischen Blumen zur Kirche kamen. Rebstöcke blühten im April, und die Getreideernte begann ungewöhnlich früh im Mai, gefolgt von einer Weinlese im Juli. Diese Ereignisse sind außergewöhnlich, da sie normalerweise Monate später stattfinden. Die extreme Milde (fast schon Wärme) war besonders in Mitteleuropa, etwa in der Schweiz und Süddeutschland, auffällig.
Die außergewöhnliche Milde des Winters 1185/86, die zu Baumblüte im Januar und haselnussgroßen Äpfeln im Februar führte, erfordert nicht nur ungewöhnlich hohe Temperaturen, sondern auch eine anhaltende Wärmeperiode, die die limitierende Wirkung der geringen Sonneneinstrahlung überwand. Dies macht den Winter 1185/86 zu einem extremen Beispiel natürlicher Klimavariabilität, das selbst im Kontext der Mittelalterlichen Klimaanomalie herausragt. Die Temperaturwerte müssen über Wochen deutlich über 10–15 °C gelegen haben, um solche phänologischen Anomalien auszulösen.
Der Winter 1185/86 gilt als der wohl mildeste Winter in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre, mit phänologischen Anomalien, die selbst im Vergleich zu anderen milden Wintern wie 1538/39 oder modernen Wintern herausragen. Seine Einzigartigkeit liegt in der extrem frühen Vegetationsentwicklung und der langen Dauer der extrem milden Bedingungen.

-
1198: Extreme Trockenheit und Hitze in ganz Europa, die 15 Wochen andauerte und zu Ernteausfällen führte.
Die Dürre von 1198 wird in mittelalterlichen Chroniken, insbesondere in deutschen und mitteleuropäischen Klosterannalen, als eine extreme Trockenperiode beschrieben, die etwa 15 Wochen andauerte. Sie trat vermutlich im Sommer und Frühherbst auf, wobei genaue Monatsangaben fehlen, da mittelalterliche Aufzeichnungen oft ungenau sind. Die betroffenen Regionen umfassten weite Teile Mitteleuropas, insbesondere das heutige Deutschland, Böhmen (Tschechien) und angrenzende Gebiete.
Chroniken berichten von ausgetrockneten Flüssen, verdorrten Feldern und einem massiven Rückgang der Ernteerträge. Es gibt Hinweise darauf, dass Brunnen und Wasserquellen versiegten, was für die damalige Zeit eine existenzielle Bedrohung darstellte.
Die Dürre von 1198 war ein extrem auffälliges Wetterereignis in Mitteleuropa, das sich durch seine Dauer (ca. 15 Wochen), die flächendeckende Ausbreitung und die schwerwiegenden Folgen (Hungersnot, ökologische Schäden) auszeichnete. Im Vergleich zu den letzten 2000 Jahren gehört sie zu den bemerkenswertesten Trockenperioden der Mittelalterlichen Warmzeit, wenn auch nicht so extrem wie die „Jahrtausenddürre“ von 1540.
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 13. Jahrhundert
-
1205/06: Laut mittelalterlichen Chroniken ein extrem langer und kalter Winter.
Schwere Hungersnöte und Missernten im Folgejahr.
-
1219 (Erste Marcellusflut): Schwere Sturmflut an der Nordsee,
besonders in den südwestlichen Regionen (heutiges Holland). Ein Orkan verursachte erhebliche Überflutungen und zahlreiche Opfer.
Die Erste Marcellusflut ereignete sich am 16. Januar 1219 und war eine verheerende Sturmflut, die vor allem die Nordseeküste des heutigen Norddeutschlands, der Niederlande und Dänemarks traf, insbesondere die Regionen Friesland und Holstein. Starke Stürme und hohe Wellen führten zu massiven Überschwemmungen, die Deiche durchbrachen und weite Landflächen verwüsteten. Historische Quellen berichten von Zehntausenden Todesopfern, wobei Schätzungen von etwa 10.000 bis 36.000 Menschen reichen. Städte und Dörfer wurden zerstört, und die Landwirtschaft in den betroffenen Gebieten erlitt schwere Schäden. Die Flut hatte langfristige wirtschaftliche Folgen, da große Teile des fruchtbaren Landes unbewohnbar wurden. Die genauen Auswirkungen sind schwer zu quantifizieren, da die Dokumentation im 13. Jahrhundert begrenzt war, aber die Flut gilt als eine der schlimmsten Naturkatastrophen ihrer Zeit.
Die Erste Marcellusflut 1219 war eine der verheerendsten Sturmfluten des Mittelalters in Mitteleuropa, mit Opferzahlen, die vermutlich in die Zehntausende gingen. Sie war weniger gut dokumentiert als spätere Fluten wie die Zweite Marcellusflut (1362) oder die Allerheiligenflut (1570), aber ihre Auswirkungen auf die Küstenregionen waren ähnlich schwerwiegend. Im Vergleich zu modernen Fluten wie 2002 oder 2021 war sie tödlicher, da Schutzmaßnahmen und Frühwarnsysteme fehlten, während die wirtschaftlichen Schäden heutzutage durch die moderne Infrastruktur oft höher sind. Die Erste Marcellusflut unterstreicht die historische Verwundbarkeit der Nordseeküste gegenüber Naturgewalten. -
1233/34: Der Winter 1233/34 war ein außergewöhnlich kalter Winter in Mitteleuropa,
der durch das Zufrieren großer Flüsse in Norddeutschland dokumentiert ist. Er war wahrscheinlich mit einer stark negativen NAO-Phase verbunden und sticht als extremes Ereignis in der ansonsten wärmeren Mittelalterlichen Warmzeit hervor. Im Vergleich zu anderen kalten Wintern der letzten 2000 Jahre steht er in einer Reihe mit Ereignissen wie dem Jahrtausendwinter 1708/09 und dem Jahrhundertwinter 1962/63, die durch bessere Dokumentation und größere geografische Ausdehnung besser untersucht sind. Während 1233/34 jedoch wie 1978/79 ein regional begrenztes (Norddeutschland) Ereignis gewesen sein könnte, zeigen spätere Winter wie 1708/09 und 1962/63 die potenziellen gesellschaftlichen und ökologischen und vor allem größeren regionalen Auswirkungen solcher Kältewellen.
-
1258: Sommer war extrem kalt, nass und trüb,
massive Ernteausfälle, Hungersnöte, Pestwellen in den Folgejahren. Gut dokumentiert in europäischen Chroniken. Größter bekannter Vulkanausbruch der letzten 1000 Jahre (unbekannte Quelle, vermutlich Indonesien)
-
1289/1290: Sehr milder Winter:
Zahlreiche Chroniken berichten von grünenden Wiesen im Dezember. Kein Schnee, kaum Frost – besonders ungewöhnlich für das Hochmittelalter
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 14. Jahrhundert
-
1302–1307: Gigantische Dürre in Mitteleuropa,
die als Vorläufer der späteren „Dante-Anomalie“ gilt. Sie markierte den Übergang vom Mittelalterlichen Klimaoptimum zur Kleinen Eiszeit und führte zu erheblichen Ernteausfällen. In den Sommer 1303 und 1304 war der Rhein praktisch ausgetrocknet.
Die genauen Todeszahlen sind nicht überliefert, aber es ist von mehreren zehntausend Todesopfern auszugehen. Dies aber hauptsächlich wegen Hungersnöten und weniger direkt wegender Hitze.
Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
Jahrhundertdürre im Mittelalter – mit Parallelen zum Klimawandel heute? -
1304: Allerheiligenflut in Deutschland.
Die Allerheiligenflut von 1304 war eine verheerende Sturmflut, die am 1. November 1304 (Allerheiligentag) die Nordseeküste Deutschlands, insbesondere die Region der Deutschen Bucht, traf. Sie gilt als eine der schwerwiegendsten Sturmfluten in der Geschichte Norddeutschlands. Besonders schwer betroffen waren die Nordfriesischen Inseln und die Küstenregionen der Deutschen Bucht. Die Flut veränderte die Küstenlinie nachhaltig, was in dieser Region nicht unüblich war, da Sturmfluten oft zu Landverlusten führten (z. B. durch die Entstehung oder Zerstörung von Inseln wie Strand).
Im Vergleich zu anderen Überschwemmungen der letzten 2000 Jahre steht sie jedoch im Schatten des Magdalenenhochwassers von 1342, das als die schlimmste Flusshochwasserkatastrophe Mitteleuropas gilt. 1304 ist eine der ersten Sturmfluten an der Nordsee um Allerheiligen (01.November), 1436 und 1570 folgten weitere schwere Allerheiligenfluten. -
1306/07: Einer der strengsten Winter der frühen Kleinen Eiszeit
Der Winter 1306/07 gilt als einer der strengsten der frühen Kleinen Eiszeit in Mitteleuropa und markiert den Übergang zu einer Phase globaler Abkühlung. Er begann ungewöhnlich früh im November 1306 mit anhaltendem Frost und starken Schneefällen, die weite Teile Deutschlands, Frankreichs und der Niederlande bedeckten. Temperaturen sanken auf Werte unter -15°C, was zu einer langen Frostperiode bis in den März 1307 führte. Besonders bemerkenswert war die vollständige Vereisung der Ostsee, ein seltenes Ereignis, das den Schiffsverkehr lahmlegte und sogar Kavallerieüberquerungen ermöglichte.
Flüsse wie Rhein, Elbe und Seine froren zu, was zu Eismärkten, aber auch zu Überschwemmungen beim Tauen führte. Der Winter war Teil einer Serie kalter Jahre (1302–1307), geprägt von ungewöhnlicher Kälte, Stürmen und Regenfällen, die den Kaspischen Meeresspiegel ansteigen ließen.
Seine Auswirkungen waren verheerend: Die extreme Kälte und der verzögerte Frühling verursachten massive Ernteausfälle, was zu Hungersnöten in Mitteleuropa führte.
Vieh starb durch Futterknappheit, Preise für Lebensmittel explodierten, und soziale Unruhen nahmen zu. Wirtschaftlich stockte der Handel, da Wege und Häfen unpassierbar waren. Historiker sehen in diesem Winter einen Vorläufer der Großen Hungersnot von 1315–1317, die Millionen Tote forderte.
Vulkanische Aktivitäten und geringe Sonnenaktivität (Wolf-Minimum) verstärkten die Abkühlung, was langfristig zu gesellschaftlichen Veränderungen beitrug, wie verstärkter Migration und feudalen Konflikten. Insgesamt war 1306/07 ein Meilenstein der Klimageschichte, der die Vulnerabilität mittelalterlicher Gesellschaften vor Klimaschwankungen unterstrich. -
1315/16: Strenger Winter,
festgestellt aufgrund von von Chroniken und Proxy-Daten.
-
1315–1321: Große Hungersnot, ausgelöst durch nasse Sommer und kalte Winter,
die zu wiederholten Ernteausfällen führten. Diese Periode wird oft mit der „Dante-Anomalie“ in Verbindung gebracht, einer Phase klimatischer Instabilität.
Beginn: In Nordwesteuropa (insbesondere in England, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland) führte eine Serie von extrem nassen Frühjahren und Sommern zwischen 1315 und 1317 zu massiven Ernteausfällen. Great Famine of 1315–1317 – Wikipedia.
Ungewöhnlich starke Regenfälle, vermutlich durch eine klimatische Abkühlung im Rahmen der Kleinen Eiszeit, führten zu Überschwemmungen, verdorbenen Ernten und Viehsterben.
Millionen Menschen starben an Hunger und Krankheiten. Die Hungersnot destabilisierte Feudalgesellschaften, führte zu sozialen Unruhen, Bauernaufständen und einer Schwächung der Autorität von Adel und Kirche. Sie verschärfte die Krise des Spätmittelalters und ebnete den Weg für weitere Katastrophen wie den Schwarzen Tod (1347–1351).

-
1322/23: Der Winter 1322/23 war durch extreme Kälte gekennzeichnet,
die zu einer Totalvereisung der Ostsee führte, ein seltener Indikator für anhaltenden Extremfrost über mehrere Wochen. Flüsse in Mitteleuropa, wie Rhein und Donau, froren vollständig zu, was den Handel und Transport erheblich beeinträchtigte. Chroniken berichten von langanhaltenden Frostperioden und erheblichen Schneemengen, die die Landwirtschaft und Infrastruktur schwer belasteten. Temperaturwerte lagen vermutlich deutlich unter dem langjährigen Mittel, mit Durchschnittswerten, die etwa 2,5 °C kälter waren als im vorindustriellen Zeitalter.
Missernten und Hungersnöte traten aufgrund der Kälte und zerstörter Ernten auf, was zu Subsistenzkrisen führte. Die Infrastruktur, einschließlich Brücken und Mühlen, wurde durch Eis und Schnee beschädigt. Chroniken beschreiben hohe Sterblichkeitsraten, teilweise durch Kälte, aber auch durch nachfolgende Seuchen.
-
1342: Magdalenenhochwasser, katastrophalste Hochwasser der letzten 2000 Jahre
Im Juli 1342 verursachten starke Regenfälle das schlimmste Hochwasser in Mitteleuropa in den letzten 2000 Jahren. Viele Flüsse erreichten historische Höchststände. Jahrhundertflut an Rhein und Main, die zahlreiche Städte verwüstete. Das Hochwasser ereignete sich rund um den St.-Magdalenentag, den 22. Juli 1342. Nach einem kalten, schneereichen Winter und einer Schneeschmelze im Februar, die bereits ein erstes Hochwasser auslöste, folgte im Juli eine extreme Wetterlage. Wahrscheinlich war eine sogenannte Vb-Wetterlage verantwortlich, bei der feuchtwarme Luftmassen vom Mittelmeer nach Mitteleuropa zogen und sich über den Mittelgebirgen ausregneten.
An vielen Flüssen wurden die höchsten jemals registrierten Wasserstände erreicht. Betroffen waren Rhein, Main, Donau, Mosel, Elbe, Moldau, Weser, Werra, Unstrut und weitere Nebenflüsse. Der Rhein in Köln erreichte schätzungsweise 13,55 m (höchster jemals gemessener Pegel), und die Donau in Passau übertraf spätere Rekorde wie 1501.
Das Magdalenenhochwasser 1342 übertrifft alle anderen Hochwasser der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa hinsichtlich der Flächendeckung, der Opferzahlen und der langfristigen ökologischen Folgen. Moderne Hochwasser wie 2002 oder 2021 waren zwar verheerend, profitierten jedoch von besseren Schutzmaßnahmen (z. B. Deichen, Frühwarnsystemen), die 1342 nicht existierten. Die Kombination aus extremen Wetterbedingungen, Entwaldung und fehlender Infrastruktur machte 1342 einzigartig katastrophal.

-
1362 (Januar): Die Zweite Marcellusflut
Die Zweite Marcellusflut, auch „Grote Mandrenke“ genannt, ereignete sich am 15.–16. Januar 1362 und war eine der verheerendsten Sturmfluten in der Geschichte Mitteleuropas. Sie traf vor allem die Nordseeküste, insbesondere die heutigen Niederlande, Nordwestdeutschland (Friesland, Ostfriesland) und Dänemark. Die schwere Sturmflut, die durch einen starken Sturm aus Nordwesten ausgelöst wurde, zerstörte in der Region Nordfriesland die wohlhabende Handelsstadt Rungholt (oft als „Atlantis der Nordsee“ bezeichnet) vollständig.
Die Surmflut mit hohen Wellen zerstörten Deiche, überschwemmten weite Landflächen und veränderten die Küstenlinie dauerhaft. Beispielsweise entstand die Jadebusenbucht, und Teile der Insel Strand (inklusive der schon genannten Stadt Rungholt) verschwanden im Meer. Schätzungen zufolge starben zwischen 25.000 und 100.000 Menschen, ganze Dörfer wurden ausgelöscht, und die Landwirtschaft brach in den betroffenen Regionen zusammen. Die Flut hatte langfristige wirtschaftliche und demografische Folgen.
Die Erste Grote Mandränke markierte einen Wendepunkt in der Geschichte Nordfrieslands. Der Verlust von Rungholt und anderen Siedlungen führte zu einem Rückgang der wirtschaftlichen Bedeutung der Region. Die Flut verstärkte die Notwendigkeit des Deichbaus, und in den folgenden Jahrhunderten wurden verstärkt Bemühungen unternommen, die Küstenregion besser zu schützen. Der Untergang von Rungholt wurde in der regionalen Kultur zu einer Legende, und archäologische Funde (z. B. Brunnen und Deichreste) haben in jüngerer Zeit die historische Realität der Stadt bestätigt.
Die Zweite Marcellusflut 1362 war eine der verheerendsten Sturmfluten in Mitteleuropa, vergleichbar mit der Allerheiligenflut 1570 in Bezug auf Opferzahlen und dauerhafte geografische Veränderungen. Im Vergleich zu Binnenhochwassern wie der Magdalenenflut 1342 war sie stärker auf Küstenregionen beschränkt, aber ebenso folgenschwer. Moderne Fluten wie 2002 oder 2021 verursachen durch verbesserte Schutzmaßnahmen weniger Todesopfer, aber die wirtschaftlichen Schäden sind durch die moderne Infrastruktur enorm. Die Marcellusflut bleibt ein Symbol für die Zerstörungskraft von Sturmfluten in der mittelalterlichen Geschichte.
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 15. Jahrhundert
-
1407/08: Einer der strengsten Winter des Spätmittelalters.
Eis auf Nordsee, Ostsee und Rhein. Sogar in England zugefrorene Flüsse.
Der Winter 1407/08 war einer der extremsten Winter des frühen 15. Jahrhunderts in Mitteleuropa, vergleichbar mit späteren Ereignissen wie 1607/08 oder 1962/63, aber weniger intensiv als der Jahrtausendwinter 1708/09. Seine Auswirkungen waren durch die damalige agrarische Gesellschaft besonders schwerwiegend. Im Kontext der letzten 2000 Jahre gehört er zu den bemerkenswerten Kälteereignissen der Kleinen Eiszeit, einer Periode, die durch häufige und intensive kalte Winter geprägt war. -
1431–1440: Eines der härtesten Jahrzehnte in der europäischen Klimageschichte,
geprägt von extremen Wintern, nassen Sommern und Hungersnöten. Der Winter 1431/32 war besonders hart, mit langanhaltendem Frost, gefolgt von Schmelzwasserfluten im Frühjahr, die Städte entlang der Donau trafen. Die Hungersnot begann 1432 in Böhmen und breitete sich aus.
-
1436: Allerheiligenflut:
Eine weitere schwere Sturmflut traf am 1. November 1436 die Nordseeküste, insbesondere Nordfriesland. Sie war so verheerend, dass das Dorf Tetenbüll unterging und die Insel Sylt schwer betroffen war (Eidum wurde zerstört, und die Bewohner gründeten später Westerland). Deiche entlang der Oste und in Kehdingen brachen, und die Insel Pellworm wurde von Nordstrand getrennt.
Auswirkungen: Die Flut forderte zahlreiche Opfer (z. B. 173 Tote allein in Tetenbüll) und führte zu dauerhaften Veränderungen der Küstenlinie.
Die Allerheiligenflut von 1436 war der von 1304 sehr ähnlich, da beide Sturmfluten waren, die die Nordseeküste trafen. Beide hatten vergleichbare Auswirkungen auf die Küstenregionen, wobei die Flut von 1436 besser dokumentiert ist und möglicherweise schwerere Schäden an der Infrastruktur verursachte, da die Küstenregionen im 15. Jahrhundert dichter besiedelt waren.
Die Flut wurde vermutlich durch eine Kombination aus starken Herbststürmen und einer ungünstigen meteorologischen Lage verursacht, die hohe Wasserstände und Wellen in die Deutsche Bucht drückte. Solche Sturmfluten waren im Mittelalter häufig, da es kaum effektiven Hochwasserschutz gab und die Küstenregionen oft nur durch einfache Deiche geschützt waren.
Nach 1304 und dem später dokumentierten Ereignis 1570 ist es die dritte Sturmflut an der Nordseeküste, die um den 01.November (Allerheiligen) auftrat. -
1453: Temperatursturz weltweit,
sehr kühler Sommer in Europa, Chroniken berichten von fehlender Reife vieler Feldfrüchte
Mysteriöser Vulkanausbruch (möglicherweise in der Südhalbkugel) -
1453: Stürme und Kälte begünstigten den Fall Konstantinopels
Die Belagerung Konstantinopels durch die Osmanen unter Mehmed II. im Frühjahr 1453 wurde durch ungewöhnliche Wetterbedingungen beeinflusst.Starke Stürme und ungewöhnlich kalte Temperaturwerte im Frühjahr behinderten die byzantinische Verteidigung, da Versorgungsschiffe nicht rechtzeitig in die Stadt gelangen konnten. Gleichzeitig nutzte Mehmed II. günstige Wetterbedingungen, um seine Flotte über Land zu transportieren und die Stadt zu isolieren.
Der Fall Konstantinopels beendete das Byzantinische Reich und markierte den Aufstieg des Osmanischen Reiches als Großmacht. Dies hatte weitreichende Auswirkungen auf Europa, einschließlich der Förderung der Renaissance durch fliehende Gelehrte und der Verschiebung von Handelsrouten. Das Wetter war ein unterstützender Faktor, der die osmanische Strategie begünstigte und die ohnehin geschwächte byzantinische Verteidigung weiter unter Druck setzte. -
1459/60: Sehr strenger Winter,
der erneut zu einer Totalvereisung der Ostsee führte, was auf eine extreme und langanhaltende Frostperiode hinweist. Historische Berichte erwähnen zugefrorene Flüsse und Seen in ganz Mitteleuropa, einschließlich des Bodensees, der nur bei extremen Wintern komplett vereist. Schneefälle waren intensiv, und die Kälte hielt über Monate an, mit Temperaturwerte, die vermutlich ähnlich stark unter dem Mittel lagen wie 1322/23. Die Ostsee war so stark vereist, dass sie teilweise begehbar war, ein Zeichen für wochenlange Temperaturwerte weit unter -10 °C.
Wie 1322/23 führte die Kälte zu Missernten, Hungersnöten und einer Verschärfung sozialer Spannungen. Der Handel, insbesondere über Wasserwege, kam weitgehend zum Erliegen, da Flüsse und Häfen unpassierbar waren. Chroniken berichten von erheblichen menschlichen Verlusten, sowohl durch direkte Kälte als auch durch nachfolgende Krankheiten.
Der Winter fiel ebenfalls in die Kleine Eiszeit, mit ähnlichen klimatischen Treibern wie 1322/23, einschließlich vulkanischer Aktivität und einer negativen Phase der Nordatlantischen Oszillation (NAO), die kalte Luftmassen nach Europa lenkte. Die Sonnenaktivität war während dieser Zeit niedrig (Spörer-Minimum), was die Abkühlung verstärkte. -
1467/68: Der Winter 1467/68 gehört zu den strengsten Wintern der Kleinen Eiszeit ,
vergleichbar mit anderen extremen Wintern wie 1607/08 oder 1657/58 („Schwedeneiswinter“), bei denen ebenfalls Flüsse zufroren. Historische Quellen berichten von zugefrorenen Flüssen wie der Weser und Elbe, die schwere Lasten tragen konnten – ein klarer Hinweis auf extreme Kälte. Dennoch war er vermutlich weniger intensiv als der Große Frost von 1708/09, der als kälteste Winter der letzten 500 Jahre gilt, mit Temperaturwerte bis −12°C in England und zugefrorenen Flüssen sogar im Süden Europas.
-
ca. 1470 bis 1560: Wärmeanomlie während der Kleinen Eiszeit:
Die Winter 1521/22, 1529/30, 1570 und 1577/78 waren in Mitteleuropa sehr wahrscheinlich mild, gestützt durch Chroniken, Proxy-Daten und das Fehlen von Berichten über extreme Kälte. Zusammen mit den heißen, trockenen Sommern von 1473, 1503, 1520, 1540, 1556 und 1590 bestätigt dies eine warme Phase in der frühen Kleinen Eiszeit, etwa zwischen 1470 und 1560. Diese Phase wurde durch klimatische Variabilität, positive NAO-Phasen (im Winter), blockierende Hochdrucklagen (im Sommer) und einer überdurchschnittlich häufig nach Norden verschobene Frontalzone verursacht. Solche warmen Anomalien zeigen, dass die Kleine Eiszeit keine monolithische Kälteperiode war, sondern Raum für regionale warme Phasen ließ, ähnlich wie moderne Klimaschwankungen.
-
1473: Extreme Trockenheit in Mitteleuropa,
die Ernten stark beeinträchtigte. Großer Dürresommer“ im späten Mittelalter. Zeitgenössische Berichte über vertrocknete Flüsse, massive Ernteausfälle, viele Menschen flohen vor Hunger, teilweise bis Oktober kein Regen.
Historische Quellen berichten von extremen Trockenheitsbedingungen in Mitteleuropa, insbesondere in Süddeutschland und der Schweiz, mit niedrigen Flusspegeln, die Fußüberquerungen kleinerer Flüsse ermöglichten. Große Flüsse wie der Rhein waren stark betroffen, aber konkrete Berichte über Fußüberquerungen sind weniger eindeutig. Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
Chroniken und Proxy-Daten (z. B. Weinlesedaten) weisen auf ein deutliches Niederschlagsdefizit hin. 1473 war zwar weniger extrem als 1540 oder 1811, aber signifikant.
These: Dürre extremer als 1540?
Die Dürre von 1473 war in Bezug auf Dauer und geografische Ausdehnung vermutlich schlimmer als die von 1540, da sie länger andauerte und ein größeres Gebiet betraf. Sie war zudem Teil einer mehrjährigen Trockenperiode, was ihre langfristigen Auswirkungen verstärkte. Die Dürre von 1540 war jedoch in ihrer Intensität (extremer Niederschlagsmangel, hohe Temperaturen) und den dokumentierten sozialen Folgen (hohe Opferzahlen, Epidemien) wahrscheinlich dramatischer.
Die Dürre von 1473 (14 Monate) dauerte länger als die von 1540 (11 Monate). Zudem war 1473 Teil einer mehrjährigen Trockenperiode (1471–1474), während 1540 ein isoliertes Ereignis war. Die Dürre von 1473 war geografisch weiter verbreitet und betraf nahezu ganz Europa, einschließlich Osteuropa und Teile Skandinaviens, während 1540 vor allem Mittel- und Westeuropa betraf.
In der Gesamtkombination Hitze, Trockenheit, Andauer und räumliche Ausdehnung belegt der Sommer 1473 ein Platz in den Top Ten der Hitliste der Sommer in Mitteleuropa. -
1479/80: Außergewöhnlich strenger Winter.
Der Winter 1479/80 war einer der kältesten der frühen Kleinen Eiszeit. Chroniken aus Süddeutschland, Polen und der Schweiz berichten von extrem niedrigen Temperaturwerten, anhaltendem Schneefall und gefrorenen Flüssen wie Rhein, Donau und Weichsel. In Krakau war die Weichsel über Monate zugefroren, und in Bayern wurden Temperaturen beschrieben, die „Mensch und Tier erstarren ließen“.
Der Winter 1479/80 war ein extrem kalter Winter in Mitteleuropa, vergleichbar mit anderen markanten Wintern wie 1564/65, 1928/29 und 1962/63, aber weniger intensiv als die außergewöhnlichen Ereignisse von 1708/09 und 1783/84. Seine Auswirkungen waren durch die Abhängigkeit von Landwirtschaft und mangelnde Infrastruktur besonders schwerwiegend, was ihn von modernen Wintern unterscheidet. In der Kleinen Eiszeit war 1479/80 ein typisches Beispiel für die kalten Extreme, die diese insgesamt eher wärmere Periode zwischen 1470 und 1560 prägten, und unterstreicht die klimatische Variabilität dieser Zeit.
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 16. Jahrhundert
-
1503, 1520, 1540, 1556, 1590: Sehr warme bis extrem heiße und trockene Sommer,
von denen 1540 der bekannteste ist.
-
1521/22, 1529/30, 1570, 1577/78:
Milde Winter mit ungewöhnlichen phänologischen Ereignissen (z. B. Blüten und Blätter an Bäumen im Dezember oder Januar). Besonders 1529/30 war extrem mild, mit Kirschenernten im Dezember und blühendem Getreide im Januar.
-
1534: Nach Trockenheit schwere Überschwemmungen.
Das Jahr 1534 in Mitteleuropa war durch einen warmen, trockenen Frühling geprägt, der in einen nassen Sommer und Herbst mit schweren Hochwassern an Rhein, Donau und anderen Flüssen überging. Chroniken aus Köln, Basel und Regensburg berichten von Überschwemmungen, die Felder zerstörten und Städte wie Freiburg im Breisgau schwer trafen. Der Rhein trat weit über die Ufer, und Brücken wurden beschädigt.
-
1537–1538: Extreme Wärmeanomalie im November und Dezember
1537, die bis Januar 1538 anhielt.
-
1538/39: Sehr milder Winter
(wahrscheinlich nach 1185/86 der zweitmildeste der letzten 2000 Jahre) mit frischen Veilchen und Kornblumen zu Neujahr. Teilweise frühlingshafte Temperaturwerte im Februar, Vegetation begann sehr früh, Obstbäume trugen Wochen früher Blüten. Frühe Blüten (Veilchen, Kornblumen im Januar) deuten auf 10–15 °C, unterstützt durch breite Baumringe und Pollenanalysen. Weniger extrem als 1185/86, aber immer noch bemerkenswert in der frühen Kleinen Eiszeit.
-
1540 (Jahrtausend-Sommer): Die schwerste Dürre und Hitzewelle der Neuzeit in Mitteleuropa, die elf Monate anhielt.
Es regnete kaum, die Temperaturwerte lagen 5–7 °C über dem Normalwert des 20. Jahrhunderts. Flüsse wie Rhein, Elbe und Seine trockneten aus, sodass man sie zu Fuß überqueren konnte. Waldbrände, Ernteausfälle und Hitzschläge führten zu geschätzten 1 Million Toten. Diese Megadürre wurde durch eine stabile Omegalage (blockierendes Hochdruckgebiet) verursacht. Chroniken berichten von Rissen im Boden, in denen Menschen ihre Füße baumeln lassen konnten. Hitze, Dürre, räumliche Ausdehnung und Andauer sind sehr wahrscheinlich auch von Hitzesommern der Moderne nicht erreicht worden. Weitere Details zum Hitzesommer 1540. und im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
In der Gesamtkombination Hitze, Trockenheit, Andauer und räumliche Ausdehnung belegt der Sommer 1540 Platz 1 der Hitliste der Sommer in Mitteleuropa.

-
1541: Nasser Sommer nach der Megadürre
Nach der extremen Dürre von 1540 war der Sommer 1541 in Mitteleuropa ungewöhnlich nass, mit starken Regenfällen, die lokal zu Überschwemmungen führten. Chroniken aus Süddeutschland und Polen berichten von hohen Flusspegeln (z. B. Elbe, Weichsel) und feuchten Bedingungen, die die Erholung der Böden nach 1540 erschwerten.
Weinlesedaten zeigen eine späte Ernte mit geringerem Zuckergehalt, ein Indikator für kühle, feuchte Bedingungen. Proxy-Daten deuten auf eine Rückkehr atlantischer Niederschläge nach der Omegalage von 1540. Berichte aus Krakau und Augsburg bestätigen nasse Verhältnisse.
Die nassen Bedingungen führten zu Ernteverlusten durch Fäulnis und erschwerten die Regeneration nach 1540. Lokale Hochwasser (z. B. an der Elbe) verursachten Schäden, aber keine flächendeckenden Katastrophen wie 1534. Der Sommer 1541 ist auffällig durch den Kontrast zur Megadürre 1540 und die regionalen Überschwemmungen. -
1551: Zahlreiche Stürme und Gewitter in Mitteleuropa,
die Ernten und Infrastruktur beschädigten.
-
1564/65: Einer der kältesten Winter der frühen Kleinen Eiszeit in Mitteleuropa.
Er zeichnete sich durch extreme Kälte, starke Schneefälle und eine lange Kältephase von November bis April aus. Große Flüsse wie Rhein, Elbe, Donau und Bodensee sowie die Themse froren komplett zu, und die Ostsee war vollständig vereist, was den Handel erheblich einschränkte. Historische Berichte dokumentieren zahlreiche Todesfälle durch Erfrierungen und Hunger, massive Viehverluste sowie Missernten aufgrund eines späten Vegetationsbeginns im Mai. Baumringanalysen zeigen enge Ringe, die auf eine kurze und kalte Wachstumsperiode hinweisen.
Der Winter 1564/65 war einer der extremsten Winter der Kleinen Eiszeit, vergleichbar mit 1708/09 und 1739/40, aber mit einer besonderen Bedeutung durch die vollständige Ostsee-Vereisung und die weitreichenden Folgen für die damalige Gesellschaft. Im Vergleich zu neueren Wintern wie 1829/30, 1939/40 und 1962/63 war 1564/65 schwerer, da die damaligen Lebensbedingungen die Auswirkungen von Kälte, Hunger und Missernten verschärften. In einer Rangliste der kältesten Winter der letzten Jahrhunderte steht 1564/65 unter den Top 5, hinter 1708/09 und 1739/40, aber vor 1939/40 und 1962/63, da die vollständige Ostsee-Vereisung und die gesellschaftlichen Folgen besonders markant waren.
-
1570 (1.–2. November, Allerheiligenflut):
Schwere Sturmflut an der Nordsee, die trotz beginnendem Deichbau große Landflächen am Jadebusen und Dollart zerstörte. 1570 gilt als eine der verheerendsten Sturmfluten des Jahrhunderts und die schlimmste aller „Allerheiligenfluten“, im Vergleich zu 1170, 1304, 1436, 1510, 1530, 1532 und 1627.
Die Allerheiligenflut von 1570 war eine verheerende Sturmflut, die am 1. und 2. November 1570 die Küstenregionen der Niederlande und Nordwestdeutschlands traf. Sie gilt als eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Region. Durch starke Winde und hohe Wellen wurden Deiche an der Nordseeküste, insbesondere in Friesland, Groningen und Zeeland, zerstört. Ganze Städte und Dörfer wurden überschwemmt, und Zehntausende Menschen verloren ihr Leben – Schätzungen reichen von 20.000 bis über 100.000 Todesopfern. Zudem wurden große Landflächen dauerhaft dem Meer überlassen, wie Teile der Region um die Zuiderzee. Die Flut hatte weitreichende wirtschaftliche und soziale Folgen, da die Landwirtschaft in den betroffenen Gebieten zusammenbrach und viele Überlebende ihre Existenzgrundlage verloren.
Die Allerheiligenflut 1570 war aufgrund ihrer enormen Opferzahlen und dauerhaften Landverluste eine der verheerendsten Naturkatastrophen in Mitteleuropa. Im Vergleich zu anderen historischen Fluten wie der Marcellusflut 1362 steht sie an der Spitze der Katastrophen, während moderne Fluten wie 2002 oder 2021 durch besseren Hochwasserschutz weniger tödlich, aber wirtschaftlich oft ebenso folgenschwer sind. Die Allerheiligenflut bleibt ein Mahnmal für die Verwundbarkeit der Küstenregionen gegenüber Naturgewalten.

-
1572/1573: Sehr kalter Winter im Rahmen der Kleinen Eiszeit.
Der Winter 1572/73 war einer der kältesten Winter in Mitteleuropa während der sogenannten Kleinen Eiszeit (ca. 1300–1850), einer Periode mit generell kälteren Temperaturwerten. Historische Aufzeichnungen, wie Chroniken und Wetterberichte, beschreiben diesen Winter als extrem streng, mit langanhaltenden Frostperioden, starkem Schneefall und gefrorenen Gewässern. Flüsse wie die Donau und der Rhein froren teilweise oder vollständig zu und den Handel sowie die Versorgung stark beeinträchtigte. In vielen Regionen wurden Hungersnöte dokumentiert, da die Kälte die landwirtschaftliche Produktion und den Transport von Lebensmitteln erschwerte. Zeitgenössische Berichte erwähnen auch, dass die Kälte zahlreiche Todesfälle durch Unterkühlung und Krankheiten verursachte.
Der Winter 1572/73 gehört definitiv zu den Top 20 der kältesten Winter der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa. Er war extrem kalt, mit gefrorenen Flüssen und gravierenden sozialen Folgen, aber Winter wie 1739/40, 1708/09, 406/07 oder 763/64 waren vermutlich noch intensiver oder hatten größere Auswirkungen. -
1588: Niederlage der Spanischen Armada:
Die spanische Armada, die England angreifen sollte, wurde durch eine Kombination aus englischen militärischen Aktionen und widrigen Wetterbedingungen besiegt. Stürme im Ärmelkanal und an der schottischen Küste zerstreuten die Flotte und führten zum Verlust vieler Schiffe. Schätzungen zufolge gingen 28 Schiffe verloren, und etwa 5.000 Männer starben durch Ertrinken, Verhungern und Schlachtungen. Diese Niederlage stärkte Englands Position als Seemacht und schwächte Spaniens Vorherrschaft in Europa erheblich. Spanish Armada – Wikipedia.

Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 17. Jahrhundert
-
1601: Kalter Sommer, Folge des Ausbruchs von Huaynaputina (Peru, 1600)
Stark unterdurchschnittliche Temperaturwerte, Kalte Sommernächte, Ernteverluste, soziale Spannungen,
Berichte von verregnetem, windigem und kühlem Sommerwetter. -
1607 (30. Januar): Die Nordseeflut von 1607, auch als Bristol Channel Flut
bekannt, war eine verheerende Sturmflut, die am 30. Januar 1607 die Küstenregionen Südwestenglands, Wales und Teile Nordwesteuropas, einschließlich Mitteleuropa, traf. Sie gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen in der Geschichte Großbritanniens und hatte auch Auswirkungen auf die Nordseeküste Mitteleuropas.
Die Sturmflut erreichte eine Höhe von etwa 7,5–8 Metern (ca. 25 Fuß) über dem normalen Meeresspiegel, was in zeitgenössischen Berichten als „ungewöhnlich hohe Welle“ beschrieben wurde. Diese Höhe war vergleichbar mit einem Tsunami, und es gibt bis heute Debatten, ob die Flut durch einen Sturm oder möglicherweise einen Tsunami ausgelöst wurde.
Die Nordseeflut von 1607 forderte schätzungsweise 2.000–3.000 Todesopfer. In Mitteleuropa waren die Auswirkungen weniger stark dokumentiert, aber die Flut trug zur langfristigen Entwicklung des Küstenschutzes bei. -
1607/08: Der Winter 1607/08 in Mitteleuropa war einer der kältesten und strengsten Winter der Kleinen Eiszeit.
Er gilt neben den Wintern 1708/09 und 1739/40 zu den Top-Kandidaten für den „Jahrtausend-Winter„.
Der Winter 1607/08, auch als „Der große Winter“ bezeichnet, war einer der extremsten Winter in der Geschichte Mitteleuropas. Er zeichnete sich durch außergewöhnliche Kälte, langanhaltenden Frost und massive Schneefälle aus. Der Winter begann im Dezember 1607 und erreichte seinen Höhepunkt im Januar 1608. Temperaturwerte sanken so stark, dass Flüsse wie die Themse, die Ostsee und der Bodensee vollständig zufroren. An der Nordseeküste wurden vereiste Küstenabschnitte dokumentiert.
In Danzig (heute Gdańsk) wurde berichtet, dass selbst nach Pfingsten (26. Mai 1608) noch Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Gräben möglich war. (Eislaufen im Mai auf gefrorenen Gewässern – wie war das möglich?)
Es gab ungewöhnlich hohe Schneemengen, selbst in Regionen wie Padua (Italien) und Spanien, die normalerweise mildere Winter erleben. In England hielt eine Schneedecke von Anfang Dezember bis zum Frühlingsäquinoktium an.
Der Winter 1607/08 war ein „Jahrtausendwinter“, vergleichbar mit 763/64, 1708/09 und 1739/40, und gehört zu den extremsten Wetterereignissen der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa. Seine außergewöhnliche Dauer, die weitreichende Kälte und die massiven Schneefälle machten ihn zu einer Katastrophe mit erheblichen Folgen für die Bevölkerung. Im Vergleich zu anderen kalten Wintern sticht er durch seine Langlebigkeit und die Betroffenheit südlicher Regionen hervor, bleibt aber in seiner Intensität vermutlich hinter 1708/09 zurück. -
1616: Schwere Dürre in den tschechischen Ländern,
die Ernteausfälle und Hungersnöte verursachte.
-
1618-1648, Dreißigjähriger Krieg stand unter dem Einfluss der Kleinen Eiszeit
Kältere Winter und Ernteausfälle: Die 1620er und 1630er Jahre waren von besonders kalten Wintern und nassen Sommern geprägt. Dies führte zu wiederholten Missernten, was die Versorgung der Bevölkerung und der Armeen erschwerte. Hunger und Unterernährung waren weit verbreitet, was die Leidensfähigkeit der Zivilbevölkerung und Soldaten weiter verschärfte.
Logistische Probleme: Extreme Wetterbedingungen wie starke Regenfälle oder lange Frostperioden behinderten die Mobilität der Armeen. Schlammige Wege erschwerten den Transport von Nachschub, Artillerie und Truppen, was die Kriegsführung verzögerte und die Plünderungen von Dörfern verstärkte, da Soldaten oft gezwungen waren, sich direkt vor Ort zu versorgen.
Krankheiten und Seuchen: Die Kombination aus Kälte, Nässe und mangelnder Hygiene begünstigte die Ausbreitung von Krankheiten wie Pest, Typhus und Ruhr. Besonders in den überfüllten Lagern und belagerten Städten führten diese Seuchen zu hohen Verlusten, die oft schlimmer waren als die direkten Kampfhandlungen.
Soziale und wirtschaftliche Auswirkungen: Die extremen Wetterereignisse verschärften die wirtschaftliche Not. Die ohnehin durch Plünderungen und Kriegssteuern geschwächte Bevölkerung litt zusätzlich unter den Folgen der Missernten, was Unruhen und Migrationen verstärkte.
Ein konkretes Beispiel ist der harte Winter 1620/21, der die Kämpfe in Böhmen und der Pfalz beeinflusste, da die Armeen in ihren Bewegungen stark eingeschränkt waren. Auch die 1630er Jahre mit ihren nassen Sommern und kalten Wintern trugen dazu bei, dass die Versorgungskrise den Krieg verlängerte und die Verwüstungen verstärkte.
Die extremen Wetterereignisse der Kleinen Eiszeit waren kein direkter Auslöser des Dreißigjährigen Krieges, aber sie verschärften die Not, erschwerten die Kriegsführung und trugen zur allgemeinen Grausamkeit und Verheerung bei. -
1620/21: Sehr kalter Winter.
Er war geprägt von extrem niedrigen Temperaturwerte und starkem Schneefall, besonders in Mitteleuropa (Böhmen, Pfalz, Süddeutschland). Historische Berichte und klimatologische Rekonstruktionen zeigen, dass Flüsse wie der Rhein und die Moldau über längere Zeiträume zufroren. Die Kälte begann früh (bereits im November 1620) und hielt bis in den März 1621 an. Dazu kamen starke Schneefälle, die die Landschaft unpassierbar machten.
Der Winter 1620/21 fiel unmittelbar nach der Schlacht am Weißen Berg (8. November 1620), in der die katholische Liga die böhmischen Aufständischen besiegte. Die extremen Wetterbedingungen erschwerten die Verfolgung der geschlagenen böhmischen Truppen, da die kaiserlichen Truppen durch Schnee und Kälte in ihrer Mobilität eingeschränkt waren.
Die Versorgungslage verschlechterte sich dramatisch. Die Armeen, die oft von Plünderungen abhängig waren, fanden in den Dörfern kaum noch Vorräte, da die vorherigen Missernten (z. B. 1619) die Bauern bereits geschwächt hatten. Dies führte zu verstärkten Übergriffen auf die Zivilbevölkerung.
Die Kälte und mangelnde Hygiene begünstigten Krankheiten wie Ruhr und Typhus, die in den überfüllten Winterlagern der Soldaten grassierten.
Der Winter 1620/21 war streng, aber vermutlich nicht so kalt wie 1708/09 oder 1941/42 in absoluten Temperaturwerte. Seine Wirkung war jedoch durch den Kontext des Dreißigjährigen Krieges besonders verheerend, da die Bevölkerung bereits durch Krieg und Missernten geschwächt war.
Im Vergleich zu 1708/09 war 1620/21 regional begrenzter, aber kriegsbedingt sozial verheerender. Gegenüber 1812/13 und 1941/42 hatte 1620/21 weniger extreme Temperaturwerte, aber die Kombination aus Krieg, Plünderungen und Seuchen machte ihn für die Zivilbevölkerung ähnlich tödlich. Der Winter verschärfte die Not im Dreißigjährigen Krieg und trug zur Verlängerung des Konflikts bei, da die Versorgungskrise die Armeen zwang, weiter zu plündern. -
1634 (Oktober): Die Burchardi-Flut
Die Burchardi-Flut von 1634, auch bekannt als Zweite Grote Mandränke, war eine der verheerendsten Sturmfluten in der Geschichte der Nordseeküste, insbesondere in Nordfriesland (heutiges Schleswig-Holstein, Deutschland, und Teile Dänemarks). Sie ereignete sich in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober 1634 und hatte katastrophale Auswirkungen auf die Region.
Die Flut zerriss die Insel Strand, die zuvor eine zentrale wirtschaftliche und kulturelle Rolle in Nordfriesland spielte. Nach der Flut entstanden die heutigen Inseln Pellworm und Nordstrand sowie kleinere Halligen. Die Landschaftsveränderungen waren so gravierend, dass die Region bis heute von diesen Folgen geprägt ist. Die Flut führte zu massiven wirtschaftlichen Verlusten, da Landwirtschaft und Handel in der Region zusammenbrachen. Viele Überlebende wanderten ab, was die Bevölkerungszahl dauerhaft reduzierte. Die Flut schwächte Nordfriesland wirtschaftlich und politisch, und die Region erholte sich nur langsam.
Die Burchardi-Flut von 1634 war eine der verheerendsten Sturmfluten in der Geschichte Nordfrieslands, mit geschätzt 8.000–15.000 Todesopfern und der Zerstörung der Insel Strand, was die Küstenlinie der Region nachhaltig veränderte. Im Vergleich zu anderen Sturmfluten steht sie in ihrer regionalen Wirkung der Ersten Grote Mandränke (1362) gleich. -
1651 (Februar/März): Petersflut
Die Petriflut (auch Petersflut genannt) von 1651 war eine der verheerendsten Sturmfluten an der Nordseeküste und bestand aus zwei aufeinanderfolgenden Ereignissen, die unterschiedliche Regionen Mitteleuropas trafen.
Die erste Flut am 22. Februar 1651 betraf vor allem die Küstenregionen von Friesland, der Deutschen Bucht und das Alte Land, während die zweite Flut am 4./5. März 1651 die Stadt Amsterdam und das Binnenland der Niederlande schwer traf. IDie Sturmflut vom 22. Februar 1651 wurde durch einen starken Nordweststurm ausgelöst, der die Wassermassen der Nordsee gegen die Küsten von Ost- und Nordfriesland, der Deutschen Bucht und das Alte Land drückte. Die Flut traf auf Deiche, die durch jahrelange Vernachlässigung und vorherige Sturmfluten geschwächt waren, was die Zerstörung verstärkte.
Schätzungen zufolge forderte die Flut etwa 15.000 Todesopfer, wobei die genauen Zahlen variieren. Siedlungen wie Dornumersiel, Accumersiel und Altensiel in Ostfriesland wurden vollständig zerstört. Das Wasser drang tief ins Landesinnere ein, bis zur Kirchwarft in Fulkum (ca. 4 km von der heutigen Küstenlinie entfernt), wo zahlreiche Leichen angetrieben und bestattet wurden.
Die Dünenketten der Inseln Juist und Langeoog wurden gespalten, und der westliche Teil der Insel Buise (zwischen Juist und Baltrum), die bereits 1362 bei der Zweiten Marcellusflut geteilt worden war, verschwand vollständig. Juist selbst wurde in zwei Teile zerrissen, eine Teilung, die bis ins späte 19. Jahrhundert bestehen blieb.,
Die Flut führte zu massiven Landverlusten und Versalzung landwirtschaftlicher Flächen, was die wirtschaftliche Basis vieler Küstengemeinden zerstörte. Die Deichpflege war damals oft in der Verantwortung einzelner Landeigentümer, die die Kosten scheuten, was die Anfälligkeit für solche Katastrophen erhöhte.
Wenige Wochen später, am 4./5. März 1651, traf eine weitere Sturmflut die Niederlande, insbesondere Amsterdam. Diese Flut war weniger durch direkte Nordseewellen, sondern durch die Kombination aus Sturm und hohen Wasserständen in den Flüssen und Kanälen des Binnenlands gekennzeichnet. Die Flüsse wie die Amstel und die Zuiderzee (heute IJsselmeer) konnten das Wasser nicht mehr ableiten, da die Sturmflut den Abfluss blockierte, was zu Binnenhochwassern führte. Die genauen Opferzahlen für diese zweite Flut sind weniger gut dokumentiert, aber Amsterdam und umliegende Gebiete wurden schwer überschwemmt. Häuser, Straßen und landwirtschaftliche Flächen standen unter Wasser, und die wirtschaftlichen Schäden waren erheblich, da Amsterdam ein zentraler Handelsknotenpunkt war.
Die zweite Flut verdeutlicht die Problematik von Binnenhochwassern, die durch hohe Außenwasserstände an der Küste entstehen. Wenn das Wasser aus dem Binnenland (z. B. durch Flüsse oder Kanäle) nicht abfließen kann, weil die Nordsee durch Sturmfluten „aufgestaut“ ist, führen selbst moderate Regenfälle oder Flusspegel zu Überschwemmungen. Dieses Phänomen wird auch in modernen Quellen als typisch für Binnenhochwasser beschrieben.
Die Petriflut von 1651 war eine doppelte Katastrophe, die durch die Kombination aus Küstensturmflut und Binnenhochwasser (durch blockierten Flussabfluss) besonders verheerend war. Sie steht in einer Reihe mit anderen großen Sturmfluten wie der Weihnachtsflut 1717 und der Burchardiflut 1634, übertrifft jedoch beide in ihrer Binnenhochwasser-Komponente, insbesondere durch die Überschwemmung Amsterdams. Die Petriflut verdeutlicht die Verwundbarkeit durch mangelhaften Küstenschutz und blockierten Wasserabfluss, ein Problem, das auch heute bei Binnenhochwassern relevant ist. Die Flut führte zu einem Umdenken im Deichbau, ähnlich wie später die Weihnachtsflut 1717, allerdings waren die Maßnahmen nach 1651 weniger systematisch, da die Deichpflege oft lokal organisiert blieb. -
1657/1658:„Schwedeneiswinter“
Januar bis Februar 1658, in der Spätphase des Dreißigjährigen Krieges, genauer während des Zweiten Nordischen Krieges. Extreme Kälte ließ nicht nur Flüsse wie den Öresund zufrieren, sondern auch: Kleine und Große Belte (Meeresengen zwischen dänischen Inseln) und Teile der Ostsee. Derartige Kälte war in der Kleinen Eiszeit nicht ungewöhnlich, aber 1657/58 war sie besonders scharf.
Karl X. Gustav von Schweden nutzte das zugefrorene Meer für einen historischen Militärmarsch, mit rund 12.000 Mann, Kavallerie und schwerem Gerät zog er über das Eis! Von der Insel Seeland bis nach Jütland – ein militärisch und logistisch eigentlich unmöglicher Zug.
Der Eismarsch wurde als „göttliches Zeichen“ für die Schweden gedeutet. Der „Schwedeneiswinter“ wurde zur Legende und ist ein Paradebeispiel für das Zusammenspiel von Wetter und Geschichte.

-
1675: Beginn monatlich aufgelöster Wetterdaten in Mitteleuropa,
die zirkulationsdynamische Analysen ermöglichen.
-
1675: Ungewöhnlich kalter Sommer,
sehr spät einsetzendes Wachstum, hohe Getreidepreise durch schlechte Ernte, zahlreiche Berichte von Dauerregen und Kälte. Kleines Sonnenfleckenminimum – Maunder-Minimum (1645–1715)
-
1683/84: Extrem kalter Winter, vor allem in Westeuropa.
Der Winter 1683/84, auch bekannt als der „Great Frost“ in England, war einer der kältesten Winter, die je in Europa aufgezeichnet wurden. In London fror die Themse für etwa sieben Wochen komplett zu, was die Durchführung eines berühmten Frost-Fairs ermöglichte, bei dem Menschen auf dem Eis Fußball spielten, tanzten und Marktstände errichteten.
Dieser Winter war Teil einer Phase extremer Wetterbedingungen, die durch eine mögliche vulkanische Aktivität oder ungewöhnliche atmosphärische Zirkulation verstärkt wurde, auch wenn die genauen Ursachen nicht eindeutig geklärt sind. Er gilt als einer der härtesten Winter seit Beginn der instrumentellen Wetteraufzeichnungen im 17. Jahrhundert und beeinflusste das Leben erheblich, insbesondere durch gestörte Handelswege und Nahrungsknappheit.
Eine ausführliche Zusammenfassung mit Verlinkungen des Winters 1683/84 von Grok (XAI) -
1694/95 extrem kalter Winter
Der Winter 1694/95 in Mitteleuropa war ein extremer Kältewinter der Kleinen Eiszeit. Er begann Ende Dezember 1694 mit anhaltendem Frost und starken Schneefällen, die zu hohen Schneewehen führten. In West- und Mitteleuropa (einschließlich Deutschland, Frankreich und den Niederlanden) sanken Temperaturen auf bis zu -20°C, Flüsse wie der Rhein und die Themse froren zu und waren begehbar. Der Frost hielt bis in den Frühling 1695 an, was zu Hungersnöten, Viehsterben und wirtschaftlichen Krisen führte. Dieser Winter war Teil der „Seven Ill Years“ (1695–1702), einer Periode mit fehlgeschlagenen Ernten durch kühles, feuchtes Wetter, was Hungersnöte und wirtschaftliche Krisen auslöste.
-
1695: Kalter, windiger und regnerischer Sommer.
Weinreben erfroren, schlechte Obst- und Getreideernte. Chroniken sprechen von „verlorenem Sommer“. Tiefpunkt der Kleinen Eiszeit, was die Not der Bevölkerung nach dem harten Winter 1694/95 weiter verschärfte. Dies war Teil der „Seven Ill Years“ (1695–1702), einer Periode mit fehlgeschlagenen Ernten durch kühles, feuchtes Wetter, was Hungersnöte und wirtschaftliche Krisen auslöste, besonders in Schottland, aber auch in weiten Teilen Europas.
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 18. Jahrhundert
-
1708/09 (Jahrtausendwinter, Der „Große Frost“):
Der Winter 1708/09 fällt in die Spätphase der Kleinen Eiszeit, die durch starke Temperaturschwankungen und häufige Kälteextreme gekennzeichnet war. Er gilt – neben dem Winter 1607/08 als einer der kältesten Winter in Europa seit 500 Jahren und wird oft als „Großer Frost“ (Great Frost) bezeichnet.
-
1717 (Dezember): Verheerende Weihnachtsflut an der Nordsee:
Die Weihnachtsflut von 1717 war eine der verheerendsten Sturmfluten in der Geschichte Mitteleuropas, insbesondere an der Nordseeküste von den Niederlanden bis Dänemark. Sie ereignete sich in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember 1717 und wurde durch einen plötzlichen Nordweststurm ausgelöst, der das Wasser gegen die maroden Deiche drückte.
Am Heiligabend 1717 ließ ein starker Südwestwind nach, was die Küstenbewohner beruhigte. Doch in der Nacht drehte der Wind auf Nordwest und entwickelte sich zu einem Orkan. Das Wasser stieg rapide, da der Wind das Niedrigwasser blockierte und die Flut verstärkte. Bereits um 3 Uhr morgens brachen in Ostfriesland und der Grafschaft Oldenburg die Deiche, und das Wasser flutete weite Landstriche.
Die Flut forderte etwa 11.500 bis 14.000 Menschenleben. In Ostfriesland allein starben 2.787 Menschen, 2.300 Pferde, 9.500 Rinder, 2.800 Schafe und 1.800 Schweine. Etwa 900 Häuser wurden zerstört und 1.800 beschädigt.
Die Deiche, bereits durch Kriege, Rinderpest und Vernachlässigung geschwächt, konnten dem Wasserdruck nicht standhalten. Die Überschwemmungen führten zu jahrelanger Versalzung landwirtschaftlicher Flächen, was Hungersnöte verursachte. Viele Bauern verschuldeten sich für Deichreparaturen, und die Kredite wurden bis ins 19. Jahrhundert zurückgezahlt. Ostfriesland verlor seine Autonomie. Einige Gebiete, wie Langeoog, wurden zeitweise unbewohnbar.
Die Flut traf die Menschen im Schlaf und während der kalten Winterzeit, was die Dramatik verstärkte. Augenzeugen berichteten von treibenden Betten, Möbeln und Leichen. Viele suchten Schutz auf Dächern oder in Kirchen, die auf Warften standen. Eine weitere Sturmflut (Eisflut) am 25./26. Februar 1718 verschärfte die Lage, da die Deiche noch nicht repariert waren.
Im Kontext der letzten 2000 Jahre steht die Weihnachtsflut in einer Reihe mit der Magdalenenflut (1342) und der Burchardiflut (1634) als eine der schlimmsten Sturmfluten. Während die Fluten des 14. und 17. Jahrhunderts größere Landverluste verursachten, hatte die Weihnachtsflut durch ihre Dokumentation und die gesellschaftlichen Folgen einen nachhaltigeren Einfluss auf den Küstenschutz und die regionale Entwicklung. -
1719: heißer Sommer:
Sommer 1719 wird in einigen Quellen als sehr heiß beschrieben, mit Berichten über Dürre in Süddeutschland und Böhmen. Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
-
1739/40: Sehr strenger und langer Winter,
gefolgt von der Irischen Hungersnot, die durch Ernteausfälle verschärft wurde. Der Winter 1739/40 war in Mitteleuropa extrem streng (vergleichbar mit 1607/08 und 1708/09) mit langanhaltendem Frost und Schneefällen, die Landwirtschaft und Handel beeinträchtigten.

-
1740/41: Strenger Winter,
festgestellt aufgrund von von Chroniken und Proxy-Daten. Aber nicht so kalt wie der vorherige Winter 1739/40.
-
1757: Heißester Sommer des 18. Jahrhunderts in Westeuropa.
Frühzeitliche Messdaten aus Paris und Zentraldeutschland zeigen enorme Hitze. In England als „Great Heat“ bezeichnet. Zahlreiche Dürreberichte, frühe Getreideernte
-
1764: Tornado von Woldegk
(29. Juni 1764, Mecklenburg, Deutschland) Stärke: F5 auf der Fujita-Skala (Windgeschwindigkeiten bis 512 km/h).
Dieser „Jahrtausendtornado“ gilt als der stärkste in Deutschland dokumentierte Tornado. Er zog eine 900 Meter breite und 30 Kilometer lange Schneise der Verwüstung. Kinder und Schafe wurden in die Luft gesaugt, eine Frau und ihre Enkelin von Trümmern erschlagen. Massive Baumstümpfe wurden ausgerissen, und Seen wurden leergesogen. Mindestens eine Tote, viele Verletzte. Die Schäden waren immens, besonders in Woldegk, aber die geringe Bevölkerungsdichte und der Feiertag (viele waren in der Kirche) verhinderten höhere Opferzahlen.
-
1770-1772: Die Große Hungersnot in Russland.
Während der Herrschaft von Katharina der Großen traf eine schwere Dürre, gefolgt von Missernten, weite Teile Russlands und Osteuropas. Besonders 1770–1772 führte dies zu einer massiven Hungersnot, die als eine der schlimmsten des 18. Jahrhunderts gilt. Millionen Menschen starben, und die Lebensmittelpreise stiegen drastisch.Die Hungersnot destabilisierte die russische Gesellschaft und verschärfte soziale Spannungen. Sie fiel zeitlich mit dem Pugatschow-Aufstand (1773–1775) zusammen, einer der größten Bauernrevolten in der russischen Geschichte. Die Unzufriedenheit mit den wirtschaftlichen Bedingungen und der staatlichen Misswirtschaft wurde als Katalysator für diesen Aufstand gesehen, der Katharinas Regime ernsthaft bedrohte. Sie musste erhebliche militärische Ressourcen einsetzen, um die Rebellion niederzuschlagen, was ihre Herrschaft konsolidierte, aber auch die Notwendigkeit von Reformen verdeutlichte.
-
1760-1780: Extreme Kälte und Überschwemmungen in Mitteleuropa.
In den 1760er- und 1770er-Jahren gab es in Mitteleuropa mehrere Perioden extremer Kälte und anschließender Überschwemmungen, insbesondere entlang der Elbe, Donau und Weichsel. Beispielsweise führten strenge Winter und plötzliche Tauwetter zu Hochwassern, die Städte wie Prag, Dresden und Krakau schwer trafen. Historische Quellen berichten von zerstörten Ernten und Infrastruktur.
Diese Ereignisse hatten Auswirkungen auf die politischen Machtverhältnisse in Mitteleuropa, insbesondere im Heiligen Römischen Reich und in Polen-Litauen. In Polen-Litauen, das unter russischem Einfluss stand, verschärften Missernten und Hochwasser die wirtschaftliche Schwäche des Staates, was die Erste Teilung Polens (1772) erleichterte, an der Russland unter Katharina der Großen maßgeblich beteiligt war. Die Unfähigkeit lokaler Herrscher, auf Naturkatastrophen effektiv zu reagieren, stärkte Katharinas Position als dominante Macht in der Region.
Extreme Wetterereignisse wie Dürren, Hungersnöte, Hochwasser und Kälteperioden hatten in Ost-, Nord- und Mitteleuropa während Katharinas Herrschaft erhebliche politische Folgen. Sie destabilisierten Gesellschaften, verschärften soziale und wirtschaftliche Krisen und boten Katharina Möglichkeiten, ihren Einfluss auszubauen – sei es durch militärische Niederschlagung von Aufständen, diplomatische Manöver oder infrastrukturelle Maßnahmen. Besonders die Hungersnot in Russland und die Missernten in Polen-Litauen waren entscheidend für die geopolitischen Entwicklungen, die Katharinas Machtposition stärkten.

-
1783/84: Extremer Winter durch Kälte, Schnee und Eishochwasser
Der Winter 1783/84 war einer der extremsten in der Geschichte Mitteleuropas, geprägt durch den Ausbruch der Laki-Krater auf Island (Juni 1783), der durch Schwefeldioxid-Emissionen einen „vulkanischen Winter“ auslöste. Ab November 1783 setzten in Mitteleuropa ungewöhnlich kalte Temperaturen ein, mit bis zu -30 °C in Heidelberg und 73 Eistagen in Prag. Flüsse wie Rhein, Elbe, Neckar und Donau froren zu, teilweise mit Eisdecken bis zu 4,6 m Dicke. Massive Schneefälle (bis zu 150 cm in Köln) lähmten Verkehr und Versorgung. Ende Februar 1784 führte ein plötzlicher Warmlufteinbruch mit Starkregen zu einem verheerenden Eishochwasser, das Städte wie Köln, Dresden und Heidelberg schwer traf, Brücken zerstörte und Hungersnöte verschärfte. Die Kombination aus extremer Kälte, Schneemengen und Hochwasserkatastrophe machte diesen Winter einzigartig.
Eine ausführliche Zusammenfassung mit Verlinkungen des Winters 1783/84 von Grok (XAI) -
1784: Überschwemmungskatastrophe im Maintal,
verursacht durch extreme Niederschläge und Schmelzwasser aus dem Extrem-Winter 1783/84.
-
1785: Kältester Frühling in Deutschland
seit Beginn der Messungen, mit einem Mittelwert von 4,0 °C.

-
1788: Hagelunwetter von Juli 1788 (Spanien bis Ostsee).
Zwei riesige Gewittercluster (MCS/MCC) zogen von Spanien/Portugal über Frankreich, Benelux, die Alpen bis zur Ostsee. Es wird als die größte Hagelkatastrophe Europas aller Zeiten angesehen. Berichte sprechen von Riesen-Hagel (Größe nicht genau dokumentiert) und Orkanböen bis 150 km/h. Sämtliche Ernten wurden zerstört, es gab Überschwemmungen, und ganze Regionen waren verwüstet. Historische Quellen wie die von Hubert Lamb beschreiben die immense Flächendeckung. Opferzahlen sind nicht genau überliefert, aber die wirtschaftlichen Folgen waren katastrophal, da die Landwirtschaft damals die Lebensgrundlage war.

-
1788/89: Extrem kalter Winter.
Der Winter 1788/89 war einer der härtesten Winter in Mitteleuropa in der Neuzeit und hatte erhebliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen. Er war durch extreme Kälte gekennzeichnet, die von November 1788 bis März 1789 anhielt. Temperaturwerte sanken in vielen Regionen Mitteleuropas auf Rekordtiefs, teilweise bis zu -20 °C oder tiefer. Starke Schneefälle und langanhaltende Frostperioden führten zu vereisten Flüssen wie der Donau, dem Rhein und der Elbe, die monatelang nicht schiffbar waren. Der Winter folgte auf einen feuchten Sommer und Herbst 1788, was die Lebensmittelversorgung bereits geschwächt hatte.Die extreme Kälte führte zu Missernten und verschärfte die Nahrungsknappheit, da Vorräte schnell aufgebraucht waren. Dies trug in Frankreich zur Verschlimmerung der sozialen Unruhen bei, die in die Französische Revolution (1789) mündeten.
Vieh starb in großen Zahlen, was die landwirtschaftliche Produktion weiter schwächte. Die eingeschränkte Mobilität durch Schnee und Eis isolierte Gemeinden und erschwerte den Handel. Berichte aus der Zeit beschreiben, wie Menschen in ihren Häusern froren, da Brennholz knapp wurde.
Der Winter 1788/89 könnte mit vulkanischen Aktivitäten in Verbindung stehen, insbesondere dem Ausbruch des Laki-Vulkans auf Island (1783–1784), dessen Aerosolausstoß das Klima in Europa für mehrere Jahre abkühlte. Eine starke negative Phase der Nordatlantischen Oszillation (NAO) begünstigte kalte Ostwinde, die kontinentale Kaltluft nach Mitteleuropa brachten.
Der Winter 1788/89 war ein extrem kaltes Ereignis, das durch seine gesellschaftlichen Folgen, insbesondere die Verschärfung der Krise vor der Französischen Revolution, in die Geschichte einging. Im Vergleich zu anderen kalten Wintern der letzten 2000 Jahre war er nicht der kälteste (1708/09 und 763/764 waren vermutlich extremer), aber seine Kombination aus klimatischen und sozialen Auswirkungen macht ihn einzigartig. -
1789: Missernten durch Wetterextreme. Grundlage für die Französische Revolution
Die Jahre vor der Französischen Revolution waren von Missernten und Hungersnöten geprägt, die die soziale Unzufriedenheit verschärften. Der Winter 1788/89 war extrem kalt, mit gefrorenen Flüssen und Ernteausfällen. Zuvor hatten Dürren (1785) und Hagelstürme (1788) die landwirtschaftliche Produktion stark beeinträchtigt. Die Hungersnot führte zu steigenden Brotpreisen, was die Armut verschärfte und soziale Unruhen auslöste. Der berühmte „Brotmarsch“ der Frauen nach Versailles 1789 war ein direkter Ausdruck dieser Not. Diese Krise war ein Katalysator für die Revolution, da sie die Unzufriedenheit mit der Monarchie und den Eliten verstärkte.
- Eine kurze Abhandlung in NationalGeographic, Klimawandel im Mittelalter: Vom Wärmeoptimum in die Kaltzeit
- Wie das Wetter die Französische Revolution beeinflusste

-
1795/96: Extrem milder Winter.
Der Winter 1795/96 in Mitteleuropa war außergewöhnlich mild und gehört zu den mildesten Wintern der späten 18. Jahrhunderts, er war durch ungewöhnlich hohe Temperaturwerte, geringe Schneefälle und frühzeitige Vegetationsperioden gekennzeichnet.
Temperaturwerte: Die Durchschnittstemperaturen lagen in vielen Regionen Mitteleuropas deutlich über dem langjährigen Mittel. In manchen Gebieten, wie Süddeutschland, wurden im Januar und Februar 1796 Temperaturwerte verzeichnet, die eher an Frühling als an Winter erinnerten (oft 5–8 °C über dem Durchschnitt). Niederschläge: Statt Schnee dominierte Regen, was zu Überschwemmungen in Flussgebieten wie Rhein und Donau führte. Schneefälle waren selten und die Schneedecke, wenn vorhanden, schmolz schnell. Historische Berichte erwähnen früh blühende Pflanzen und eine verlängerte landwirtschaftliche Saison. Bauern konnten teilweise bereits im Februar mit der Aussaat beginnen, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Der Winter war von starken atlantischen Tiefdrucksystemen geprägt, die milde, feuchte Luftmassen aus dem Westen brachten. Dies führte zu einer stabilen Westlage, die kalte kontinentale Luftmassen aus Osteuropa fernhielt.
Vergleich mit anderen historischen Wintern:-
Winter 1733/34: Ebenfalls sehr mild, mit ähnlichen Merkmalen wie 1795/96 (wenig Schnee, frühe Vegetation). Beide Winter wurden durch starke westliche Zirkulationen begünstigt.
-
Winter 1833/34: Ein weiterer milder Winter, der jedoch in manchen Regionen durch stärkere Schwankungen zwischen milden und kurzen kalten Phasen auffiel, im Gegensatz zur konstanten Milde von 1795/96.
-
Winter 1974/75: Dieser moderne milde Winter zeigt Parallelen, da er ebenfalls durch eine stabile Westlage und hohe Temperaturwerte gekennzeichnet war. Allerdings war die Milde 1795/96 in manchen Regionen extremer, da sie weniger Kaltlufteinbrüche aufwies.
-
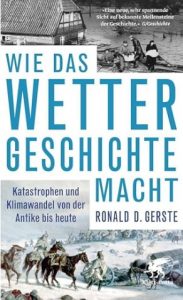
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 19. Jahrhundert
-
1800: Tornado von Hainichen (Sachsen, Deutschland)
Stärke: F5 auf der Fujita-Skala (Windgeschwindigkeiten bis 512 km/h).
Der zweite bestätigte F5-Tornado in Deutschland. Er hinterließ eine 50 Meter breite Schneise, in der kein Baum stehenblieb – entwurzelte Stämme wurden hunderte Meter weit geschleudert. Konkrete Opferzahlen sind nicht überliefert, aber die Zerstörung war verheerend. Wälder wurden vollständig vernichtet, und die Schäden waren in der dünn besiedelten Region enorm. -
1811: Extrem heißer und trockener Sommer.
Der Sommer 1811 in Mitteleuropa war einer der heißesten Sommer der letzten Jahrhunderte, geprägt von extremen Temperaturwerten und langanhaltender Trockenheit. Historische Aufzeichnungen beschreiben ihn als ungewöhnlich warm, mit Hitzewellen, die zu erheblichen Ernteausfällen und Wasserknappheit führten, insbesondere in Regionen wie Deutschland, Frankreich und den Alpenländern. Die Temperaturwerte lagen deutlich über dem Durchschnitt der damaligen Zeit, und es gab Berichte über ausgetrocknete Flüsse und Brunnen.
Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„.
Im Vergleich zu anderen heißen Sommern der letzten Jahrhunderte, wie dem extremen Sommer 1540 (vermutlich der heißeste in der europäischen Klimageschichte mit katastrophalen Dürren und Hungersnöten) oder dem Sommer 2003 (mit massiven Hitzetoten und Waldbränden), steht 1811 in seiner Intensität nahe an der Spitze. 1540 war jedoch noch extremer, mit Temperaturen, die Schätzungen zufolge bis zu 7 °C über dem langjährigen Durchschnitt lagen, während 1811 „nur“ etwa 3–5 °C über dem Durchschnitt lag. Moderne Sommer wie 2003 oder 2018 übertreffen 1811 in Bezug auf die gesellschaftlichen Folgen (z. B. durch höhere Bevölkerungsdichte und städtische Hitzeinseln), aber 1811 bleibt ein markantes Beispiel für einen extremen Sommer in der vorindustriellen Ära.
Der Sommer 1811 war in Mitteleuropa extrem heiß und trocken, mit erheblichen Auswirkungen auf die Landwirtschaft, und zählt zu den heißesten Sommern der letzten Jahrhunderte, übertrifft aber nicht die Intensität von 1540 und ist mit modernen Hitzesommern wie 2003 vergleichbar.
In der Gesamtkombination Hitze, Trockenheit, Andauer und räumliche Ausdehnung belegt der Sommer 1811 vermutlich Platz 4 der Hitliste der Sommer in Mitteleuropa.

-
1812/13: Früher Beginn eines strengen Winters in Russland während Napoleons Invasion 1812 (Große Armee)
Der Winter begann ungewöhnlich früh, bereits im Oktober 1812. Historische Berichte beschreiben, dass bereits Mitte Oktober in der Region um Moskau Schnee fiel und die Temperaturwerte unter −10 °C sanken. Der Winter war extrem streng. Im November 1812, während des Rückzugs der Grande Armée aus Moskau, fielen die Temperaturwerte auf −20 bis −30 °C. Zeitgenössische Quellen berichten von Tiefstwerten bis −35 °C im Dezember 1812, insbesondere in der Region um Smolensk und während der Überquerung der Beresina. Dichte Schneefälle und Stürme begleiteten den Rückzug. Der Schnee lag in der Region um Moskau bis zu 1 m hoch, und Verwehungen machten Straßen unpassierbar. Die russische Steppe bot keinen Schutz vor den eisigen Winden, und die Armee war schlecht ausgerüstet (z. B. fehlende Winterkleidung).
Napoleon marschierte im Juni 1812 mit etwa 600.000 Mann in Russland ein. Die russische Taktik der „verbrannten Erde“ zwang die Armee zum Rückzug, und der frühe Winter verschärfte die Lage. Beim Rückzug starben Zehntausende an Kälte, Hunger und Krankheiten (z. B. Typhus). Am Ende überlebten nur etwa 50.000 Mann. Die Kälte zerstörte die Versorgungslinien. Pferde starben massenhaft (über 200.000), was die Artillerie und den Nachschub lahmlegte. Mehr zum Russlandfeldzug von Napoleon 1812.
Bei Napolens Invasion 1812 begann der russische Winter sehr früh und war sehr streng. Diese Bedingungen waren zwar nicht entscheidend, aber eine wichtige Komponente für die Niederlagen der Armee, da sie auf die Kälte und Logistikprobleme nicht vorbereitet waren. -
1815: Schlacht von Waterloo.
Der Ausgang dieser Schlacht wurde durch heftigen Regen in der Nacht vor der Schlacht beeinflusst. Der Regen verwandelte das Schlachtfeld in ein Schlammfeld, was die Bewegung von Napoleons Artillerie und Kavallerie behinderte und den Angriff verzögerte. Diese Verzögerung ermöglichte es den Preußen unter Blücher, rechtzeitig einzutreffen und die Alliierten zum Sieg zu führen, was Napoleons endgültige Niederlage und den Beginn einer Neuordnung Europas einleitete. Die Schlacht von Waterloo.
-
1816 („Jahr ohne Sommer“):
Der Sommer 1816 war der kälteste der modernen Ära, mit Temperaturwerten in Mitteleuropa etwa 2–3 °C unter dem Mittel (ca. 13 °C statt 16 °C). Der Ausbruch des Vulkans Tambora (1815) in Indonesien verursachte eine globale Abkühlung durch Aerosole. In Deutschland schneite es im Juni (z. B. Bayern), und es gab Frost im Juli.
-
1825 (Februar): Große Halligflut.
Diese Sturmflut traf am 3./4. Februar 1825 die Nordseeküste, insbesondere die nordfriesischen Inseln und Halligen. Orkanböen und hohe Wasserstände führten zu Deichbrüchen und Überschwemmungen. Etwa 800 Menschen starben, tausende Tiere ertranken, und landwirtschaftliche Flächen wurden versalzen. Besonders betroffen waren Pellworm, Föhr und die Halligen.
Die Februarflut 1825 war weniger tödlich als die Weihnachtsflut 1717, da die Opferzahlen deutlich niedriger waren. Die Weihnachtsflut hatte zudem eine größere geografische Reichweite (von den Niederlanden bis Dänemark) und führte zu nachhaltigeren gesellschaftlichen Veränderungen, wie der Abschaffung der Autonomie in Ostfriesland. -
1829/30: Der Winter 1829/30 war der kälteste des 19. Jahrhunderts
(−6,6 °C) und einer der kältesten der letzten 200 Jahre, nur übertroffen von historischen Extremen wie 1708/09 und 1739/40. Im Vergleich zu 1962/63 war er kälter, und gegenüber den Kriegswintern 1939/40–1941/42 hatte er niedrigere Temperaturwerte. Er fällt in die Spätphase der Kleinen Eiszeit (ca. 1300–1850) und war durch extreme Kälte, langanhaltenden Frost und erhebliche Schneefälle geprägt. In Berlin wurden Tiefstwerte von bis zu −27 °C gemessen, und in Süddeutschland (z. B. München) sanken die Temperaturwerte auf −30 °C. Der Januar 1830 war der kälteste Monat, mit Tagesmitteln von −15 °C in vielen Regionen.
Die Kälte begann Ende November 1829 und hielt bis März 1830 an, also etwa vier Monate ununterbrochener Frost. Es gab erhebliche Schneefälle, besonders im Januar und Februar. Im Tiefland (z. B. Norddeutsches Tiefland) lagen bis zu 50 cm Schnee, in den Mittelgebirgen sehr starke Verwehungen von teilweise mehreren Metern.Eisbildung: Große Flüsse wie der Rhein, die Elbe und die Donau froren vollständig zu, ein seltenes Ereignis. Der Bodensee war komplett vereist („Seegfrörne“), und die Ostsee fror großflächig zu, sodass Menschen zwischen Inseln auf dem Eis reisen konnten. -
1830: „Unser deutscher Sommer ist nur ein grün angestrichener Winter“,
Heinrich Heine schrieb die Aussage in seinem Werk Reisebilder. Dritter Teil. Reise von München nach Genua, das 1830 veröffentlicht wurde. Die genaue Entstehung lässt sich auf die späten 1820er Jahre datieren, da die Reisebilder auf seinen Reiseeindrücken von 1826–1829 basieren. Einerseits verglich Heine den deutschen Sommer mit dem im Mittelmeerraum, auf der anderen Seite stand er auch unter dem Eindruck der vielen kühlen Sommer dieser Zeit, in denen man oft wärmende Kleidung benötigte.
-
1830er–1850er: Kälteste Phase in der Frühlingsperiode,
mit sehr kalten Frühjahren wie 1837 (4,7 °C), 1845 (4,4 °C) und 1853 (4,6 °C).
-
1833/34: Sehr milder Winter.
Der Winter 1833/34 wird in den historischen Klimadaten Österreichs als einer der wärmsten Winter seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen im Jahr 1767 geführt. In der Rangliste der wärmsten Winter in Österreich belegt er den siebten Platz.
Diese ungewöhnliche Milde war bemerkenswert, da sie in eine Zeit fiel, in der Europa regelmäßig von harten Wintern betroffen war. Solche Abweichungen von den üblichen klimatischen Bedingungen hatten oft erhebliche Auswirkungen auf Landwirtschaft und Gesellschaft.
-
1834: Extrem heißer und trockener Sommer
Der Sommer 1834 war ein außergewöhnlicher Jahrhundertsommer in Mitteleuropa, geprägt von extremer Hitze und Trockenheit, mit erheblichen Auswirkungen auf Landwirtschaft und Wasserressourcen. Historische Berichte und Proxydaten deuten auf eine extreme Hitzeperiode hin, die mit modernen Hitzesommern wie 2003 vergleichbar ist. Schätzungen basierend auf frühen Messungen (z. B. in Berlin oder Wien) legen nahe, dass die Temperaturen regelmäßig 30 °C überstiegen, mit Spitzenwerten vermutlich bis zu 35 °C in manchen Regionen.
Trockenheit: Der Sommer 1834 war nicht nur heiß, sondern auch außergewöhnlich trocken. Historische Quellen beschreiben ihn als „Jahrhundertsommer“ mit anhaltenden Dürreperioden, die zu Ernteausfällen und Wasserknappheit führten.
Landwirtschaft: Die extreme Hitze und Trockenheit führten zu erheblichen Ernteverlusten, insbesondere bei Getreide und Obst. Historische Berichte aus Deutschland und Österreich erwähnen gestiegene Lebensmittelpreise und Versorgungsengpässe.
Wasserressourcen: Flüsse wie der Rhein und die Donau hatten Niedrigwasserstände, was den Handel und die Schifffahrt beeinträchtigte. In ländlichen Gebieten gab es Berichte über ausgetrocknete Brunnen.
Der Sommer 1811 war in Mitteleuropa jedoch noch heißer und trockener als der Sommer 1834, basierend auf den dokumentierten Temperaturen, der Intensität der Dürre und den wirtschaftlichen Folgen. -
1845-1852: Irische Kartoffel-Hungersnot
Diese Hungersnot wurde durch die Kartoffelpflanzenkrankheit Phytophthora infestans verursacht, deren Ausbreitung durch feuchtes und kühles Wetter begünstigt wurde. Die Ankunft der Krankheit im Jahr 1844 und ihre Verbreitung bis Mitte August 1845 in Europa verschärften die Lage. Schätzungen zufolge starben über eine Million Menschen, und Millionen emigrierten, was die demografische und soziale Struktur Irlands nachhaltig veränderte. Great Famine (Ireland) – Wikipedia.
-
1868: Aufbau eines flächendeckenden Messstationsnetzes im Norddeutschen Bund,
was die Wetteraufzeichnungen erheblich verbesserte.
-
1879/80: Der Winter 1879/80 war einer der kältesten und schneereichsten der späten Kleinen Eiszeit,
mit Temperaturwerten von −10 bis −15 °C und einer Schneedecke von etwa 90 Tagen. Im Vergleich zu 1708/09 und 1829/30 war er milder, aber er übertraf moderne Winter wie 1962/63 und 1978/79 in der Kälteintensität. Gegenüber den Kriegswintern 1939/40–1941/42 war 1879/80 kälter und die extremen Schneefälle und Verwehungen von 1879/80 machten ihn zu einem der härtesten Winter des 19. Jahrhunderts, nur übertroffen von 1829/30. Der Winter war besonders lang und frostig, mit Kältephasen von Dezember 1879 bis März 1880.
Es gab erhebliche Schneefälle, mit einer geschlossenen Schneedecke über etwa 90 Tage. In Norddeutschland (z. B. Bremen) wurden Schneehöhen von bis zu 60 cm gemessen, in den Alpen und Mittelgebirgen über 1,5 m. Verwehungen waren ein großes Problem, besonders in England, wo der Winter als „The Great Freeze“ bekannt wurde. Der Rhein fror bei Bingen zu, ebenso wie die Elbe und Teile der Ostsee. In den Niederlanden waren Kanäle wie das IJsselmeer vereist, und in England froren Flüsse wie die Themse teilweise zu.

Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa 20. Jahrhundert
-
1904: Sehr trockener Sommer in Böhmen.
Die Elbe war zu Fuß begehbar. Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
-
1911: Extrem heißer und trockener Sommer,
in Berlin wurden im Juli 34 °C, in Jena 39 °C gemessen, und Zürich verzeichnete 42 Tage über 30 °C. Die Hitze war so intensiv, dass in Berlin eine Sitzung des preußischen Landtages abgebrochen wurde.
Der Sommer 1911 in Mitteleuropa war einer der bemerkenswertesten Hitzesommer des frühen 20. Jahrhunderts. Er war geprägt von außergewöhnlich hohen Temperaturen und langanhaltenden Hitzewellen, besonders in den Monaten Juli und August. Historische Aufzeichnungen und frühe meteorologische Daten zeigen, dass die Temperaturen in vielen Teilen Mitteleuropas, einschließlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien, 2–4 °C über dem damaligen Durchschnitt lagen, mit Spitzenwerten, die in manchen Regionen 35 °C überschritten. Die Trockenheit war ebenfalls signifikant, was zu Ernteverlusten und Wasserknappheit führte, obwohl die Dürre nicht so extrem war wie in anderen historischen Sommern wie 1540 oder 2003.
Im Vergleich zu anderen heißen Sommern der letzten Jahrhunderte, wie 1540 (extremste Megadürre), 2003 (massive Hitzetote) oder 1811 (sehr heiß und trocken), war der Sommer 1911 in seiner Intensität vergleichbar mit 1811, aber weniger katastrophal als 1540 oder 2003. Gegenüber modernen Sommern wie 2018 oder 2022 hatte 1911 weniger ausgeprägte gesellschaftliche Folgen, da die Bevölkerungsdichte und Urbanisierung geringer waren, was hitzebedingte Auswirkungen milderte. Dennoch war 1911 ein bemerkenswerter Sommer, der in historischen Berichten als „Hitzesommer“ festgehalten wurde.
Zusammengefasst: Der Sommer 1911 war in Mitteleuropa sehr heiß und trocken, mit Temperaturen und Auswirkungen, die ihn in die Nähe von Sommern wie 1811 oder 2018 rücken, aber hinter Extremereignissen wie 1540 oder 2003 zurückbleiben.

-
1911: Zusätzlich war das gesamte Jahr 1911 in Mitteleuropa war insgesamt deutlich wärmer als der Durchschnitt,
das wärmste Jahr in Mitteleuropa zwischen 1874 und 1946, wobei der Sommer (insbesondere Juli und August) der herausragendste Teil des Jahres war. Meteorologische Aufzeichnungen zeigen, dass 1911 zu den wärmsten Jahren des frühen 20. Jahrhunderts gehörte. Neben dem extrem heißen Sommer mit Temperaturanomalien von 2–4 °C über dem Durchschnitt waren auch Frühling und Herbst ungewöhnlich mild. Insbesondere der Frühling 1911 verzeichnete in Regionen wie Deutschland und Frankreich überdurchschnittliche Temperaturwerte, während der Winter 1910/11 relativ mild war, aber keine extremen Werte erreichte.
Die ganzjährige Temperaturanomalie lag in Mitteleuropa vermutlich bei etwa 1–1,5 °C über dem langjährigen Durchschnitt (bezogen auf die damalige Klimanorm). Trockenheit war vor allem im Sommer prägnant, weniger jedoch über das gesamte Jahr, da Frühling und Herbst teilweise normale oder sogar überdurchschnittliche Niederschläge brachten. Im Vergleich zu anderen warmen Jahren, wie etwa 2003 oder 2022, war 1911 ganzjährig warm, aber die Extreme konzentrierten sich auf den Sommer. Historisch gesehen steht 1911 in einer Reihe mit anderen warmen Jahren wie 1895 oder 1947, war aber weniger extrem als die Intensität moderner Hitzerekordjahre. -
1912: Kühlster und nassester Sommer des 20. Jahrhunderts.
Der Sommer 1912 war vermutlich der kühlste und nasseste Sommer des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa, mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 15,2 °C und extrem hohen Niederschlägen (über 300 mm in manchen Regionen), die zu Überschwemmungen führten. Während 1965 der kühlste Sommer war, übertrifft 1912 diesen durch die Kombination von Kühle und extremen Niederschlägen. Andere Sommer wie 1903, 1965, 1974 oder 1980 waren ebenfalls kühl und nass, aber weniger extrem in ihrer Kombination. Die Datenlage für 1912 wird durch DWD-Berichte und historische Niederschlagsanalysen gestützt
-
1921: Schwere Dürre,
besonders auf den Britischen Inseln, aber auch in Teilen Mitteleuropas. Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
-
1928/29: Einer der kältesten und schneereichsten Winter des 20. Jahrhunderts.
Er zeichnete sich durch außergewöhnlich niedrige Temperaturwerte, anhaltende Frostperioden und starke Schneefälle aus, die in vielen Regionen zu erheblichen Beeinträchtigungen führten.
Der Frost setzte bereits im Dezember 1928 ein und hielt bis in den März 1929 an, mit besonders intensiven Kältewellen im Januar und Februar.
Der Winter wurde durch ein stabiles Hochdruckgebiet über Skandinavien und Nordosteuropa beeinflusst, das kalte kontinentale Luftmassen aus Sibirien nach Mitteleuropa brachte, eine typische Ostlage.
In Deutschland wurde der Februar 1929 als „Schwarzer Februar“ bezeichnet, da die Kälte extreme Ausmaße erreichte. In Berlin fiel die Temperatur am 11. Februar 1929 auf -26 °C, ein Rekord für die Stadt. Flüsse wie die Elbe, Donau und der Rhein froren teilweise zu, was den Schiffsverkehr lahmlegte.
Der Winter 1928/29 war einer der kältesten Winter des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa, vergleichbar mit 1962/63, aber weniger extrem als die Winter der Kleinen Eiszeit wie 1708/09. Im Vergleich zu den historischen Wintern der letzten 2000 Jahre war er nicht ganz so extrem wie die außergewöhnlichen Winter des Frühmittelalters (535/536 oder 763/764), da diese durch globale klimatische Ereignisse (z. B. Vulkanausbrüche) verstärkt wurden. Dennoch war 1928/29 für die moderne Zeit bemerkenswert, da die Kombination aus tiefen Temperaturwerten, starken Schneefällen und langen Frostperioden erhebliche Herausforderungen für eine industrialisierte Gesellschaft mit sich brachte.

-
1932 (Februar): Die tiefste je in Mitteleuropa gemessene Temperatur betrug −52,6 °C
und wurde am 19. Februar 1932 in der Doline Grünloch in den Ybbstaler Alpen, Niederösterreich, aufgezeichnet. Diese Doline, auf 1270 m Seehöhe gelegen, gilt als Kältepol Mitteleuropas, da die kesselartige Topografie kalte Luft ansammelt und extreme Tiefsttemperaturen begünstigt, besonders bei klaren Nächten, Schneebedeckung und Windstille.
Es gibt keine dokumentierten Temperaturwerte in Mitteleuropa, die tiefer als −52,6 °C liegen.
Außerhalb Mitteleuropas, aber noch in Europa, wurde 1978 in der Nähe des Uralgebirges eine Temperatur von −58,1 °C gemessen, was den europäischen Kälterekord darstellt. In Mitteleuropa selbst bleibt das Grünloch mit −52,6 °C unübertroffen. Neuere Messungen, wie −47,1 °C am 25. Dezember 2003 im Grünloch, bestätigen die außergewöhnliche Kälte dieser Region, erreichen aber nicht den Rekord von 1932. -
1934 (Juli): Schweres Weichselhochwasser.
Das Weichselhochwasser von 1934 war ein schweres Hochwasserereignis, das im Juli 1934 entlang der Weichsel (polnisch: Wisła) in Polen stattfand. Es gilt als eine der verheerendsten Fluten in der Geschichte Polens im 20. Jahrhundert.
Das Hochwasser hatte den Höhepunkt zwischen dem 17. und 22. Juli 1934. Es wurde durch anhaltende starke Regenfälle ausgelöst, die zu einem extremen Anstieg des Wasserpegels der Weichsel führten. Intensive Regenfälle in den Karpaten, dem Quellgebiet der Weichsel, führten zu einer schnellen Wasserzunahme. Die Sommerzeit begünstigte zudem die Bildung von Starkregenereignissen, die die Flut verstärkten.
-
1939/40 bis 1941/42 (strenge Kriegswinter): Die Kriegswinter 1939/40 bis 1941/42 waren außergewöhnlich kalt
(−5,0 bis −2,8 °C) und gehören zu den strengsten des 20. Jahrhunderts, nur übertroffen von 1962/63. Im Vergleich zu 1708/09 und 1739/40 waren sie milder, aber die Kriegsumstände verschärften die Folgen. Gegenüber 1995/96 und der Serie 2008/09–2012/13 waren sie deutlich kälter und schneereicher, was sie in der Klimageschichte besonders herausstellt.
-
1940: Kältestes Jahr seit Beginn regelmäßiger Messungen.
Die gemittelten Jahresmitteltemperaturen für Paris, Berlin, Warschau, Kopenhagen, Wien, Zugspitze und Brocken ergaben einen Wert von 5,9°C, im Vergleich dazu betrug das Mittel im wärmsten Jahr 2024 9,1°C.
Andere kalte Jahre wie 1963 oder 1816 („Jahr ohne Sommer“) könnten ähnlich kalt gewesen sein, aber Daten sind für die genannten Messstationen weniger vollständig. -
1941/42: Früher Beginn eines strengen Winters in Russland beim deutschen Feldzug im Zweiten Weltkrieg (Operation Barbarossa)
Der Winter setzte bereits Ende Oktober 1941 ein, früher als erwartet. In der Region um Moskau (wo die Wehrmacht im Dezember 1941 stand) sanken die Temperaturwerte Mitte November auf −20 °C, und im Dezember 1941 wurden −40 °C gemessen (z. B. in Klin, nordwestlich von Moskau).
Der Winter 1941/42 war einer der kältesten des 20. Jahrhunderts in Russland. Im Januar 1942 fielen die Temperaturwerte in der Region Stalingrad auf −35 °C, und in Leningrad wurden −42 °C gemessen. Die Kälte wurde durch starke Winde („Purgas“) verschärft, die die gefühlte Temperatur noch niedriger machten. Dichte Schneefälle begleiteten die Kälte, mit Schneedecken von 1–1,5 m in der Region Moskau und bis zu 2 m in Waldgebieten. Verwehungen behinderten den Nachschub. Mehr zum Ablauf des strengen Kriegswinter 1941/42.
Die Wehrmacht startete die Operation Barbarossa im Juni 1941 mit etwa 3 Millionen Soldaten, war aber nicht auf einen Winterkrieg vorbereitet. Die Kälte führte zu massiven Ausfällen bei Maschinen (Panzer froren ein, Gewehre funktionierten nicht), und Soldaten litten unter Erfrierungen (über 100.000 Fälle). Die Rote Armee nutzte die Kälte für Gegenoffensiven (z. B. Schlacht um Moskau, Dezember 1941), die die Wehrmacht zurückdrängten. Die Wehrmacht hatte keine Winterausrüstung (z. B. fehlende Stiefel, Mäntel), und die Versorgung brach zusammen. Eisenbahnen froren ein, und Nachschub kam nicht durch. Mehr zum Zweiten Weltkrieg inklusive offener Fragen.- Sowohl bei Napoleons Invasion 1812 als auch beim deutschen Feldzug 1941–1943 im Zweiten Weltkrieg spielten diese extremen Wetterbedingungen eine wichtige Rolle bei den militärischen Niederlagen der Invasoren. Bei Napoleons Invasion 1812 waren jedoch logistische Probleme, die Taktik der verbrannten Erde durch die Russen, Guerillaangriffe und die Weite des Landes vorentscheidend. Der Winter verschärfte die ohnehin prekäre Situation erheblich, war aber nicht allein ausschlaggebend.
Bei der deutschen Invasion 1941 (Unternehmen Barbarossa) war der Winter 1941/42 tatsächlich ein entscheidender Faktor, insbesondere während der Schlacht um Moskau. Die Wehrmacht war schlecht auf die extremen Temperaturen vorbereitet, was zu massiven Problemen bei Ausrüstung, Versorgung und Moral führte.
- Sowohl bei Napoleons Invasion 1812 als auch beim deutschen Feldzug 1941–1943 im Zweiten Weltkrieg spielten diese extremen Wetterbedingungen eine wichtige Rolle bei den militärischen Niederlagen der Invasoren. Bei Napoleons Invasion 1812 waren jedoch logistische Probleme, die Taktik der verbrannten Erde durch die Russen, Guerillaangriffe und die Weite des Landes vorentscheidend. Der Winter verschärfte die ohnehin prekäre Situation erheblich, war aber nicht allein ausschlaggebend.

-
1946/47: Er galt nach dem Krieg als der Hungerwinter.
Der Winter 1946/47 war einer der kältesten und folgenreichsten Winter des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa. Er war geprägt durch extreme Kälte, massive Schneefälle und eine katastrophale Versorgungslage in der Nachkriegszeit, die zu erheblichen humanitären Krisen führte.
Temperatur: Der Winter 1946/47 war durch drei große Kältewellen gekennzeichnet: November 1946, Dezember 1946 und Januar 1947. Temperaturwerte sanken häufig unter -20 °C, mit Spitzenwerten von bis zu -25 °C in einigen Regionen. In Deutschland war es der viertkälteste Winter im Zeitraum von 1881 bis 2020, in Wien gab es im Januar 1947 23 Eistage (Tage, an denen die Temperatur nicht über 0 °C stieg).
Massive Schneefälle führten zu hohen Schneedecken, die das öffentliche Leben lahmlegten. In Städten wie Hamburg, Berlin und Wien waren Straßen und Schienen oft unpassierbar. In Wien berichtete Bürgermeister Theodor Körner von „noch nie dagewesenen Schneemassen“ und einer „lang andauernden Periode strengsten Frostes“.
Die Kälte begann bereits im Oktober 1946 mit leichtem Frost und hielt bis März 1947 an, wobei der Januar 1947 die härteste Kältewelle brachte. Die Frostperiode dauerte in manchen Regionen über 40 Tage.
Gesellschaftliche Auswirkungen: Die Nachkriegszeit verschärfte die Auswirkungen des Winters erheblich. Lebensmittelrationen lagen oft unter 1000 Kalorien pro Tag, weit unter den von Experten geforderten 2000–2500 Kalorien. In Städten wie Köln, Hamburg und Berlin standen Menschen stundenlang für Lebensmittel an, und Schwarzmarktaktivitäten („fringsen“ nach Kardinal Frings’ Silvesterpredigt 1946, die Mundraub in der Not rechtfertigte) waren weit verbreitet.
Viele Flüsse, wie die Elbe und der Rhein, froren zu, was die Binnenschifffahrt lahmlegte. Der Eisgang im März 1947 zerstörte Brücken, wie in Bremen („Bremer Eiskatastrophe“) und Vohburg an der Donau.
Kohle- und Heizstoffmangel führte zu Strom- und Gasabschaltungen. In Wien brachen Stromnetze zusammen, und der Missbrauch von Gasheizungen verursachte zahlreiche Gasvergiftungen (880 Tote in Wien 1946 durch Leuchtgasunfälle).
Historiker schätzen, dass in Deutschland mehrere Hunderttausend Menschen an Hunger und Kälte starben. Besonders betroffen waren geschwächte Stadtbewohner, Flüchtlinge und Vertriebene (ca. 10 Millionen in Deutschland). Krankheiten wie Hungerödeme, Tuberkulose und Verdauungsstörungen waren weit verbreitet.
Der Winter 1946/47 war ein „Jahrhundertwinter“ aufgrund seiner extremen Kälte, massiven Schneefälle und der verheerenden humanitären Krise, die durch die Nachkriegsnot verstärkt wurde. Während meteorologisch kältere Winter wie 1708/09, 1739/40 oder 1962/63 auftraten, war die Kombination aus Kälte, Hunger und Infrastrukturzerstörung in 1946/47 einzigartig. Historiker schätzen, dass Hunderttausende in Deutschland an Kälte und Hunger starben.

-
1947: Der Sommer 1947 in Deutschland war extrem heiß, trocken und sonnig,
mit einer Durchschnittstemperatur von 18,5 °C, etwa 2,1 °C über dem langjährigen Mittel (1961–1990). Er folgte dem Hungerwinter 1946/47, der sehr kalt war (−4,6 °C), und markierte einen krassen Kontrast. Der Sommer war geprägt von anhaltendem Hochdruckwetter mit Rekord-Sonneneinstrahlung und schwerer Dürre, Ernteausfällen und Wasserknappheit führte. Temperaturspitzen erreichten in Süddeutschland über 35 °C, und in Berlin wurden 38 °C gemessen. Die Dürre verschärfte die Nachkriegsprobleme, da Lebensmittel knapp waren, und Waldbrände waren weit verbreitet.
Hier eine kurze Dokumentation, veröffentlicht von Professor Stefan Homburg auf XGroße Dürre 1947
Es gab es noch kein Fernsehen, aber man konnte im Kino die von den Besatzern erlaubten Ereignisse der Woche ansehen. Damals wurden unzählige halbverhungerte Tiere notgeschlachtet. Niemand redete von „Klimawandel”.Hintergrund: Die Dürre 1947 belastete die… pic.twitter.com/HunqVt1Plr
— Stefan Homburg (@SHomburg) June 15, 2025
-
1952 (Juli): Markante Hitzewelle in Deutschland.
Berlin erreicht am 02.Juli 1952 35°C und Erfurt 37°C. In Neustadt/Weinstraße und Mengen werden mit 39,6°C nur knapp 40°C verfehlt.
-
1953 (Monatswechsel Januar/Februar, schwere Nordseeflut)
Die Nordseeflut von 1953, auch bekannt als Hollandsturmflut, Watersnoodramp (in den Niederlanden) oder Great North Sea Flood (in Großbritannien), war die schwerste Sturmflut des 20. Jahrhunderts an der Nordsee. Sie ereignete sich in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1953 und hatte verheerende Auswirkungen auf die Küstenregionen der Niederlande, Großbritanniens, Belgiens und in geringerem Maße auch Deutschlands.
Die Nordseeflut von 1953 war eine der schlimmsten Naturkatastrophen des 20. Jahrhunderts in Europa, mit etwa 2.400–2.500 Todesopfern, 200.000 Hektar überflutetem Land und massiven Schäden in den Niederlanden, Großbritannien und Belgien. Sie wurde durch einen Orkan, eine Springflut und unzureichende Deiche verursacht und führte zu bedeutenden Verbesserungen im Hochwasserschutz -
1956 (Februar): Außergewöhnliche Kälte.
In Deutschland sanken die Temperaturwerte oft auf -20 °C bis -30 °C, besonders in der zweiten Monatshälfte. Rekordwerte wurden beispielsweise in Bayern verzeichnet, wo Orte wie Regensburg und München Temperaturwerte um -25 °C meldeten.
Massive Schneefälle begleiteten die Kälte, in Städten wie Berlin und Hamburg führten Schneeverwehungen zu Verkehrschaos.
Die Kältewelle begann Ende Januar 1956 und hielt fast den gesamten Februar an, mit einer besonders intensiven Frostperiode zwischen dem 10. und 25. Februar. In vielen Regionen gab es mehrere Wochen ohne Tauwetter. Eine Ostlage, starkes Hochdruckgebiet über Skandinavien und Nordosteuropa brachte kalte sibirische Luftmassen nach Mitteleuropa, was zu anhaltendem Frost und klaren, kalten Nächten führte.
Der Februar 1956 war einer der kältesten Februarmonate des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa, mit Temperaturwerten um -10 °C im Durchschnitt und Spitzen bis -30 °C. Kälter waren vermutlich die Februarmonate von 1709, 1740, 1784, 1830 und 1929, die tiefere Temperaturwerte, längere Frostperioden oder extremere klimatische Bedingungen aufwiesen. Vor dem 18. Jahrhundert könnten Februarmonate wie 763/764 oder 1234 ebenfalls kälter gewesen sein, aber die Datenlage ist unsicherer. Der Februar 1956 bleibt jedoch ein markantes Ereignis, das durch seine Intensität und die erheblichen Schneefälle in die meteorologische Geschichte einging. -
1962 (Februar): Die Sturmflut von 1962, auch als „Hamburger Sturmflut“ bekannt,
war eine der schwersten Naturkatastrophen in Deutschland im 20. Jahrhundert. Sie ereignete sich in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 und traf vor allem die deutsche Nordseeküste, insbesondere Hamburg, mit verheerender Wucht. Ein Orkantief namens „Vincinette“, das vom südlichen Nordpolarmeer über Island und das Europäische Nordmeer nach Südschweden zog, verursachte die Katastrophe. Es brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h (Windstärke 12, teils jenseits der Messgrenzen damaliger Geräte) und trieb gewaltige Wassermassen in die Deutsche Bucht.
Insgesamt forderte die Sturmflut 347 Todesopfer, davon 315 in Hamburg und 19 in Niedersachsen. Neun Soldaten kamen bei Rettungsarbeiten ums Leben. Über 60 Deichbrüche wurden in Hamburg verzeichnet, weitere entlang der Elbe und ihrer Nebenflüsse (z. B. Oste). In Niedersachsen gab es 61 Deichbrüche, besonders im Niederelberaum zwischen Otterndorf und Bremervörde. Über 6.000 Gebäude wurden zerstört, 20.000 Menschen mussten evakuiert werden, und etwa 100.000 Hamburger waren von den Wassermassen eingeschlossen. Rund 50.000 Nutz- und Haustiere ertranken.

-
1962/63: Der Jahrhundertwinter des 20. Jahrhunderts in Europa.
Der Winter 1962/63 gilt mit einem Mittelwert von −5,5 °C in Deutschland als einer der strengsten des 20. Jahrhunderts in Europa, insbesondere in Deutschland, wo er als der kälteste dieses Jahrhunderts eingestuft wird, mit einer ungewöhnlich langen Frostdauer, die einem 250-jährigen Ereignis entspricht. Langanhaltende Kälte und Schneefälle lähmten weite Teile Mitteleuropas.
Im Vergleich zu anderen Wintern der letzten Jahrhunderte war er nur von den extremsten Kälteperioden, wie 1683/84, 1708/09, 1739/40 oder 1829/30 in der Central England Temperature-Reihe (seit 1659) übertroffen, während er den Kriegswintern 1939/40 bis 1941/42 und den Nachkriegswinter 1946/47 in Härte übertraf. Seine Dauerfrostphase mit bis zu 120 aufeinanderfolgenden Eistagen und der vollständige Gefrierpunkt vieler Flüsse, wie Rhein und Bodensee, machen ihn zu einem außergewöhnlichen Ereignis, das selbst den strengen Wintern von 1879/80 oder 1829/30 in Westeuropa nahezu ebenbürtig ist, wobei der Schnee jedoch im Alpenraum ungewöhnlich spärlich war. Weitere Details zum Jahrhundertwinter 1962/63.
Der Jahrhundertwinter 1962/63 -
1964 (November): Sehr kalt und schneereich im östlichen Mitteleuropa.
Der November 1964 war in Mitteleuropa ein flächendeckend kalter Monat, mit einer starken Kältewelle, die von polaren und arktischen Luftmassen geprägt wurde. Die kräftigsten Schneefälle und beständigsten Schneedecken konzentrierten sich jedoch auf das östliche Mitteleuropa.
Im Vergleich zu anderen Novembermonaten der letzten Jahrhunderte steht der November 1964 beispielsweise in Berlin in einer Reihe mit den Jahren 1919 (höchste Schneedecke in der ersten Dekade), 1941 (kräftige Schneefälle) und 1974 (extrem schneereich in anderen Regionen). Keiner dieser Monate übertrifft 1964 eindeutig in Berlin selbst, was den November 1964 zu einem der markantesten Wintereinbrüche des 20. Jahrhunderts in der Stadt macht. Seine Einzigartigkeit liegt in der Kombination aus frühem Schneefall, beständiger Schneedecke und der Einbettung in eine Kältephase der 1960er Jahre. Der November 1964 gehört daher zu den Top-5 der kältesten und schneereichsten Novembermonate in Berlin seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. -
1965: Kühlster Sommer des 20.Jahrhunderts
Der Sommer 1965 gilt in Mitteleuropa als einer der kühlsten des 20. Jahrhunderts. Laut Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag die Durchschnittstemperatur in Deutschland bei etwa 14,8–15,0 °C, deutlich unter dem langjährigen Mittel von ca. 16,5–17 °C. Insbesondere der Juli war außergewöhnlich kühl, mit Temperaturen, die regional nur 13–14 °C erreichten. In Österreich und der Schweiz wurden ähnliche Anomalien verzeichnet, mit Temperaturen 1,5–2 °C unter dem Durchschnitt. Der Sommer war von Tiefdrucksystemen geprägt, die kalte Luftmassen aus dem Nordatlantik brachten, was zu wenigen sonnigen Tagen und seltenen Temperaturen über 25 °C führte.
-
1969/70: Kalter Winter mit langer Schneedecke.
Temperaturmäßig war er milder als 1962/63, die Kriegswinter oder historische Winter wie 1607/08. Der Winter 1969/70 war in Berlin durch die ununterbrochene Schneedecke von 120 Tagen (durchgehend Anfang Dezember bis Ende März) außergewöhnlich, eine Dauer, die selbst kalte Winter wie 1962/63 (71 Tage) oder 1978/79 (67 Tage) übertrifft. Die Schneedeckendauer macht 1969/70 besonders, auch wenn andere Winter (z. B. 1978/79) durch Verwehungen katastrophaler waren.
-
1974: Regensommer, der Rudi Carrell zu seinem Lied
„Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?“ inspirierte.
Der Sommer 1974 war ein typischer Regensommer, geprägt von kühlen Temperaturwerten und überdurchschnittlichen Niederschlägen, jedoch ohne die extremen Folgen von Regensommern wie 1816 oder 1845, die mit Hungersnöten und massiven Ernteausfällen verbunden waren. Im Vergleich zu anderen Regensommern (z. B. 1965, 1980, 2007) war 1974 ähnlich in seiner kühlen und nassen Witterung, aber kulturell einzigartig durch die Inspiration zu Carrells Lied. Er war weniger extrem als die katastrophalen Regensommer der Kleinen Eiszeit, aber dennoch ein „verlorener Sommer“ im kollektiven Gedächtnis. -
1976: Heißer und trockener Sommer:
Der Sommer 1976 war in Deutschland einer der heißesten und trockensten Sommer des 20. Jahrhunderts. Mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 18,2 °C (deutlich über dem langjährigen Mittel) und bis zu 17 aufeinanderfolgenden Hitzetagen (Tmax ≥ 30 °C) in manchen Regionen war er geprägt von extremen Hitzewellen und einer ausgeprägten Dürre. Niederschläge waren stark unterdurchschnittlich, was zu erheblichen Ernteausfällen, Waldbränden und Niedrigwasserständen (z. B. am Rhein) führte. Weinjahrgänge waren hervorragend aufgrund der sonnigen und warmen Bedingungen.
Der Sommer 1976 war ein extremer Hitzesommer mit starker Dürre, vergleichbar mit 1911 und 1947, aber weniger intensiv als die Rekordsommer 2003, 2018, 2023 und erst recht 1540. Die Kombination aus Hitze und Trockenheit machte ihn zu einem der markantesten Sommer des 20. Jahrhunderts in Deutschland. -
1978/79: Katastrophenwinter in Norddeutschland,
mit riesigen Schneemassen, Stromausfällen und abgeschnittenen Landesteilen. Der Winter 1978/79 war in Norddeutschland besonders durch die Kombination aus plötzlichem Temperatursturz, extremen Schneefällen und meterhohen Verwehungen. Gegenüber kälteren Wintern wie 1962/63, den Kriegswintern 1939/40–1941/42 oder 1946/47 war die Kälte weniger intensiv, aber die Schneemassen und Verwehungen waren beispiellos in der Nachkriegszeit. Historische Winter wie 1607/08 waren ähnlich streng, hatten aber andere gesellschaftliche Auswirkungen. Im Vergleich zu moderneren Wintern (1995/96, 2008/09–2012/13) sticht 1978/79 durch seine Katastrophenwirkung heraus, da die damalige Infrastruktur und Wettervorhersage weniger fortgeschritten waren.

-
1983 (Juli): Heißester Juli des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa.
Der gesamte Sommer 1983 war in Deutschland ein überdurchschnittlich warmer und trockener Sommer, allerdings weniger extrem als andere Jahrhundertsommer. Die Durchschnittstemperatur lag etwa bei 18,0 °C (ca. 1,5 °C über dem langjährigen Mittel), mit mehreren Hitzetagen (Tmax ≥ 30 °C), insbesondere im Juli und August. Niederschläge waren unterdurchschnittlich, was regionale Trockenheit verursachte, jedoch ohne die Schwere anderer Dürre-Jahre. Weinjahrgänge waren gut, was auf sonnige und warme Bedingungen hinweist, aber es gab keine extremen Ernteausfälle oder Niedrigwasserstände wie in anderen Dürrejahren.
-
1984: Hagelsturm von München (12. Juli 1984).
Ein extremes Unwetter traf München und Südbayern nach einer Hitzewelle. Eine Kaltfront führte zur Bildung massiver Quellwolken, und Hagelkörner mit bis zu 9,5 cm Durchmesser (ca. 300 g) fielen. Der Hagelsturm dauerte 20–30 Minuten, das Unwetter insgesamt 2,5 Stunden, und hinterließ eine 20 cm hohe Hagelschicht.Über 70.000 Gebäude und 200.000 Fahrzeuge wurden beschädigt, mehrere hundert Menschen verletzt. Es gab keine direkten Todesopfer, aber einige starben durch Herzinfarkt oder bei Aufräumarbeiten. Der Schaden belief sich auf 1,5 Milliarden Euro – der größte für die deutsche Versicherungswirtschaft bis dahin. Die Feuerwehr hatte über 3.800 Einsätze.
-
1984: 24.November 1984, höchste offiziell gemessene Windgeschwindigkeit auf dem Brocken im Harz mit 263 km/h.
Die Windgeschwindigkeit von 263 km/h (entspricht etwa 73 m/s) wurde an der Wetterstation auf dem Brocken, die seit 1939 in Betrieb ist, aufgezeichnet. Diese Station liegt auf dem Gipfel des Brockens (1.142 m ü. NHN), dem höchsten Berg des Harzes, und ist bekannt für die Erfassung extremer Wetterereignisse. Der damalige Wetterbeobachter Anton Lochmann erlebte den Sturm hautnah. Aus Angst, dass die Fenster der Wetterstation dem Druck nicht standhalten könnten, suchte er Schutz im Keller. Dies verdeutlicht die extreme Gewalt des Sturms.
Die 263 km/h waren ein absoluter Spitzenwert und übertrafen selbst die Windstärken an anderen windigen Orten wie der Zugspitze oder der Nordseeinsel Helgoland (ca. 30 km/h im Mittel).Es gibt Hinweise, dass ein noch stärkerer Orkan im Januar 1938 über den Brocken fegte, mit einer inoffiziellen Windspitze von 291,6 km/h (81 m/s). Allerdings ist diese Messung nicht offiziell anerkannt, da das Aufzeichnungsgerät überlastet war und einen Defekt erlitt. Der Windstreifen, der diese Messung dokumentieren könnte, gilt als verschollen, weshalb der 24. November 1984 weiterhin als Rekordtag gilt.
Noch extremer als der Brocken ist oft die „große Schwester“ Schneekoppe im Riesengebirge. Siehe auch Klimaverhältnisse auf den höchsten Mittelgebirgsgipfeln Mitteleuropas und Wetter und Webcams Berge.
Exponierte Mittelgebirgsgipfel, wie beispielsweise Brocken (Harz), Fichtelberg (Erzgebirge), Feldberg (Schwarzwald) oder Schneekoppe (Riesengebirge) fallen bei entsprechender Wetterdynamik mit extremen Windgeschwindigkeiten auf, die man sich im Tiefland kaum vorstellen kann. -
1986 (Sehr kalter Februar):
Der Februar 1986 war ein sehr kalter Monat in Mitteleuropa, mit Durchschnittstemperaturwerten von -7 bis -9 °C und Spitzen bis -25 °C. Kälter waren die Februarmonate von 1709, 1740, 1784, 1830, 1929 und 1956, die tiefere Temperaturwerte, längere Frostperioden oder extremere klimatische Bedingungen aufwiesen. Immerhin war der Februarmonat 1986 ähnlich kalt wie die von 1947 und 1963. In Essen (Ruhrgebiet) war es nach 1929 und 1956 der drittkälteste Februar des 20.Jahrhunderts.
-
1988 (März, Großer Arber): Außergewöhnliche Schneehöhe
von etwa 380 cm am Großen Arber (Bayerischer Böhmerwald), eine der höchsten jemals gemessenen in Mitteleuropa. Sämtliche Mittelgebirge verzeichneten rekordverdächtige Schneehöhen. Im Februar und März 1988 kam es wiederholt zu Nordwestlagen, die eine enorme Akkumulation des Schnees bis Ende März ermöglichte. Siehe auch Klimaverhältnisse auf den höchsten Mittelgebirgsgipfeln Mitteleuropas und Wetter und Webcams Berge.
-
1995/96 (Ostwind-Winter): Der „Ostwind-Winter“ 1995/96 war in Mitteleuropa ein bemerkenswert kalter Winter,
der sich durch eine dominante meridionale Zirkulationsform auszeichnete, bei der kalte Ostwinde aus Osteuropa vorherrschten. In Deutschland variierten die Temperaturmittel zwischen -1,7 °C und -4,6 °C, was kälter war als viele Winter der 1990er, die oft milder ausfielen. Im historischen Vergleich war er jedoch deutlich milder als die Jahrhundertwinter 1962/63 (-5,5 °C) oder 1940 (-5,0 °C) und erst recht als die Jahrtausendwinter 1708/09 und 1740. 1708/09 und 1740 hatten Temperaturwerte von -15 °C bis -25 °C, gefrorene Flüsse wie den Rhein und massive Ernteausfälle, während 1995/96 keine vergleichbaren Extremwerte oder gesellschaftlichen Krisen aufwies.
An der Ostsee war es der letzte echte Eiswinter, bei dem küstennahe Meerareale zufroren. Im Vergleich zu schneereichen Wintern wie 1962/63 (71 Schneedeckentage) oder 1978/79 war er jedoch schneearm, was durch eine große Frosteindringtiefe (in Brandenburg teilweise mehr als ein Meter) Schäden an der Vegetation hinterließ. -
1996 (die meisten Frosttage in Berlin seit 1952)
Bedingt durch den kalten Winter 1995/96 (Ostwind-Winter) und das frühzeitige Winterwetter im Dezember 1996 weist das Kalenderjahr 1996 die meisten Frosttage (Tagestiefsttemperatur <0,0°C) in Berlin-Dahlem auf. Seit mindestens 1952 gab es kein Jahr mit mehr Frosttagen in Berlin. (Klimadaten Berlin-Dahlem)
-
1997 (Juli/August), Oderflut (Jahrtausendflut)
Die Oderflut von 1997, auch als Jahrtausendflut bekannt (polnisch: Powódź Tysiąclecia), war das schwerste Hochwasserereignis an der Oder in der Geschichte Tschechiens, Polens und Deutschlands. Sie ereignete sich im Juli und August 1997 und verursachte massive Schäden und zahlreiche Opfer.
Die Flut wurde durch eine sogenannte Vb-Wetterlage ausgelöst, bei der Tiefdruckgebiete (Xolska und Zoe) feucht-warme Luft vom Mittelmeer und Schwarzen Meer nach Mitteleuropa transportierten. Diese trafen auf kühle Luftmassen im Norden, was zu extremen Niederschlägen führte. Zwei Starkregenperioden waren entscheidend:
4.–9. Juli 1997: Tief Xolska verursachte sintflutartige Regenfälle in den tschechischen und polnischen Gebirgen (Riesengebirge, Altvatergebirge, Sudeten). Bis zu 586 mm Regen pro Quadratmeter fielen in den Karpaten, was die Böden sättigte und die Retentionsfähigkeit drastisch reduzierte.
Mitte Juli: Eine zweite Regenperiode verstärkte die Flut, da die Böden bereits kein Wasser mehr aufnehmen konnten.
Tschechien: Besonders die Regionen im Riesengebirge und Altvatergebirge, wie Jeseník, waren schwer betroffen. Weite Landstriche standen unter Wasser.
Polen: Städte wie Breslau, Opole (Oppeln), Słubice, und Racibórz erlitten massive Überschwemmungen. Die Ziltendorfer Niederung auf polnischer Seite war ebenfalls betroffen.
Deutschland: In Brandenburg waren das Oderbruch, die Ziltendorfer Niederung, Frankfurt (Oder), Eisenhüttenstadt, Bad Freienwalde, Küstrin-Kietz, und Hohenwutzen besonders betroffen. Die weiten Polderflächen im unteren Odertal halfen, schlimmere Schäden zu verhindern, da sie Wasser aufnahmen.
Die Oderflut von 1997 war eine der schlimmsten Hochwasserkatastrophen in Mitteleuropa, mit über 100 Todesopfern, 4,13 Milliarden Euro Schäden, und massiven Überschwemmungen in Tschechien, Polen und Deutschland. Sie wurde durch extreme Regenfälle in einer Vb-Wetterlage ausgelöst und führte zu beispielloser Solidarität, symbolisiert durch die „Einheitsflut“. -
1999 (26.12.), Weihnachtsorkan Lothar
Der Orkan Lothar war ein verheerendes Sturmtief, das am 26. Dezember 1999 (zweiter Weihnachtsfeiertag) West- und Mitteleuropa traf und als einer der schlimmsten Winterstürme des 20. Jahrhunderts gilt. Besonders betroffen waren Nordfrankreich, die Schweiz, Süddeutschland und Teile Österreichs.
Lothar entstand als kleine Tiefdruckwelle über dem Nordatlantik vor der amerikanischen Ostküste am 24. Dezember 1999. Innerhalb von 24 Stunden entwickelte es sich explosionsartig zu einem Orkantief mit einem Kerndruck von 961 hPa nordwestlich von Paris am Morgen des 26. Dezembers. Der rasante Druckabfall (z. B. in Karlsruhe von 1005 hPa am 25. Dezember auf 975 hPa am 26. Dezember innerhalb von 12 Stunden) war beispiellos und zeigte die extreme Dynamik des Sturms.
Lothar war ein sogenannter „Schnellläufer“, der sich mit etwa 100 km/h von der Bretagne über Nordfrankreich, Luxemburg, Süddeutschland (über Frankfurt bis zur Lausitz) bis zu den Karpaten bewegte. Die Hauptzerstörung in Süddeutschland und der Schweiz fand zwischen 10:00 und 12:30 Uhr statt.
Windgeschwindigkeiten: Spitzenböen erreichten extreme Werte:
272 km/h auf dem Hohentwiel bei Singen (Deutschland).
259 km/h auf dem Wendelstein (Bayern).
242 km/h auf dem Feldberg im Schwarzwald.
230 km/h auf dem Säntis (Schweiz).
Diese Werte waren in vielen Regionen Rekordwerte, und einige Messgeräte, wie am Feldberg, fielen bei über 200 km/h aus.
Orkan Lothar war eine der schlimmsten Naturkatastrophen in Mitteleuropa, mit 110–140 Todesopfern, über 15 Milliarden Euro Schäden und massiven Waldverlusten (z. B. 30 Millionen Festmeter in Baden-Württemberg, 14 Millionen Kubikmeter in der Schweiz). Er führte zu Verbesserungen in Warnsystemen und zu einer Umstellung auf robustere Laubmischwälder. Der Lotharpfad und andere Denkmäler erinnern an die Katastrophe und die natürliche Regeneration des Waldes.
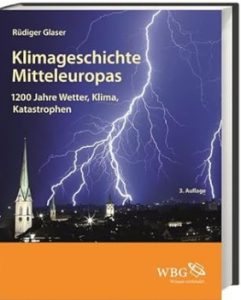
Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa im 21. Jahrhundert
-
2002: Hochwasser in Mitteleuropa.
Im August 2002 kam es zu schweren Überflutungen in Deutschland, Tschechien und Österreich. Mindestens 45 Menschen starben, und die Schäden beliefen sich auf etwa 15 Milliarden Euro.
-
2003: Jahrhundertsommer, der als der heißeste seit 1540 gilt.
Eine Omegalage führte zu Temperaturwerte über 40 °C (z. B. 8 Tage in Auxerre, Frankreich) und einer geschätzten Todeszahl von 45.000–70.000, besonders in Frankreich und Italien. Die Dürre verursachte Ernteausfälle und wirtschaftliche Schäden in Höhe von etwa 13 Milliarden US-Dollar. Mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„
Der Sommer 2003 war in Mitteleuropa außergewöhnlich durch seine extreme Hitze und Trockenheit, die als eine der schlimmsten Hitzewellen seit Jahrhunderten gilt. Besonders August 2003 war geprägt von Temperaturwerten, die teilweise 5–7 °C über dem langjährigen Durchschnitt lagen, mit Spitzenwerten über 40 °C (z. B. in Süddeutschland und Frankreich). Die Hitzewelle führte zu erheblichen gesundheitlichen Belastungen (ca. 70.000 hitzebedingte Todesfälle in Europa), Ernteausfällen und Waldbränden. Niedrige Niederschläge verschärften die Dürre, besonders in Südeuropa.
Vergleich mit anderen Hitzesommern:
1540 (Megadürre): Der Sommer 1540 war vermutlich noch extremer, mit geschätzten Temperaturanomalien von bis zu 7–10 °C über dem Durchschnitt und extremen Dürren in ganz Europa. Flüsse wie der Rhein trockneten teilweise aus. Daten sind jedoch weniger präzise, da es keine systematischen Wetteraufzeichnungen gab. Historische Berichte deuten auf katastrophale Ernteausfälle und Hungersnöte hin. Die Todesfälle lagen mit geschätzten 500.000 bis zu einer Million deutlich höher, aber damals gab es auch noch keine Klimaanlagen.
2018: Dieser Sommer war ebenfalls sehr heiß und trocken, besonders in Nord- und Mitteleuropa. Temperaturwerte lagen etwa 3–5 °C über dem Durchschnitt, mit langen Trockenperioden, die Landwirtschaft und Wasserreserven belasteten. Im Vergleich zu 2003 war die Hitze weniger intensiv, aber die Dürrephase länger anhaltend, was zu vergleichbaren wirtschaftlichen Schäden führte.
2022: Der Sommer 2022 war geprägt von mehreren Hitzewellen, besonders im Juli und August, mit Temperaturwerte über 40 °C in Westeuropa (z. B. Großbritannien, Frankreich). Die Dürre war schwerwiegend, besonders in Südeuropa (Italien, Spanien). Im Vergleich zu 2003 war die Hitze in manchen Regionen ähnlich intensiv, aber die Hitzewellen waren kürzer und regional unterschiedlicher verteilt.
In der Gesamtkombination Hitze, Trockenheit, Andauer und räumliche Ausdehnung belegt der Sommer 2003 vermutlich Platz 2 der Hitliste der Sommer in Mitteleuropa. -
2005 (November): „Münsterländer Schneechaos“
– Größter Stromausfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte
Im November 2005 führte eine extreme Wetterlage in Nordwestdeutschland, insbesondere im Münsterland, zu massiven Schneefällen und dem sogenannten „Münsterländer Schneechaos“. Am 25. November 2005 begann ein kräftiges Tiefdruckgebiet namens „Thorsten“, das vom Nordmeer über die Niederlande und Nordwestdeutschland zog, für ungewöhnlich starke Schneefälle. Innerhalb von 12 bis 24 Stunden fielen 30 bis 50 cm Nassschnee, lokal sogar über 50 cm, was für diese Region, die normalerweise wenig Schnee erlebt, außergewöhnlich war. Die Temperaturwerte lagen um den Gefrierpunkt, wodurch der Schnee schwer und feucht blieb.
Dieser nasse Schnee setzte sich auf Hochspannungsleitungen ab und bildete zentimeterdicke Eispanzer, die zusammen mit starkem bis stürmischem Wind extreme Belastungen verursachten. Durch die sogenannten Leiterseilschwingungen, bei denen die vereisten Kabel meterweit schwangen, wurden die Strommasten überlastet. Insgesamt knickten 82 Strommasten wie Streichhölzer um, was den größten Stromausfall in der deutschen Nachkriegsgeschichte auslöste und etwa 250.000 Menschen teilweise tagelang ohne Strom ließ.
Die Wetterlage war durch einen Kaltlufteinbruch aus dem Norden geprägt, gefolgt von einem nahezu ortsfesten Tief über Nordwestdeutschland, das wiederholt Schneefälle über dieselben Gebiete brachte. Besonders betroffen waren das Münsterland, das Tecklenburger Land, das Osnabrücker Land, das südliche Emsland und der Osten der Niederlande. Der Gesamtschaden wurde auf rund 100 Millionen Euro geschätzt. -
Winter 2005/2006: Sehr kalter Hoch- und Spätwinter.
Nach dem „Münsterländer Schneechaos“ gab es eine milde Phase bis in den Januar 2006 hinein. Anschließend war der Winter 2005/2006 in Mitteleuropa geprägt von einer markanten Kältephase, insbesondere im März 2006, die ihn zu einem der kälteren Winter der jüngeren Vergangenheit machte. Im Februar und besonders im März 2006 kam es zu einer extremen Kältewelle, die durch ein stabiles Hochdruckgebiet über Skandinavien und kalte Ostwinde aus Sibirien verursacht wurde. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sanken die Temperaturwerte teilweise auf unter -20 °C. Der März 2006 war in vielen Regionen der kälteste seit Jahrzehnten. In Deutschland lag die Durchschnittstemperatur in einigen Regionen um 3–4 °C unter dem langjährigen Mittel.
Der Winter 2005/2006 war in Mitteleuropa durch seine späte, aber sehr intensive Kältewelle im März bemerkenswert und gehört zu den kälteren Wintern der letzten Jahrzehnte. Im Vergleich zu extremen Wintern wie 1962/1963 war er weniger durchgehend kalt, aber die Schneemengen und die März-Kälte machten ihn in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz lokal ähnlich beeindruckend. Gegenüber den milderen Wintern der 2000er-Jahre sticht er klar heraus, bleibt aber hinter den extremsten Wintern des 20. Jahrhunderts zurück.

-
2006: Sehr heißer Juni und Juli, das „Sommermärchen in Deutschland“
Der Sommer 2006 war in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein überdurchschnittlich warmer Sommer, der durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland (das „Sommermärchen“) (Video wurde aus der ARD Mediathek leider gelöscht, hier eine Kurzversion des Sommermärchens 2006) kulturell geprägt wurde. Die Monate Juni und Juli waren besonders heiß und sonnig, was die fröhliche Stimmung der WM verstärkte, während der August kühler und nasser war, was den Sommer davon abhielt, ein absoluter Rekordsommer zu werden. Es gab das (unbestätigte) Gerücht, dass eine afrikanische Fußball-Mannschaft sich wünschte, lieber am kühleren Abend als in den heißen Nachmittagsstunden zu spielen.
Der Sommer 2006 hatte das Potential, ein Rekordsommer zu werden, da Juni und besonders Juli außergewöhnlich heiß waren und mit den Rekordjahren 2003 (19,7 °C) oder 2018 (19,2 °C) konkurrierten. Der kühle und nasse August senkte jedoch die Gesamtdurchschnittstemperatur auf 18,8 °C, weshalb der Sommer hinter 2003 und 2018 zurückblieb. Ohne den August wäre 2006 wahrscheinlich ein Top-Rekordsommer gewesen.

-
2006/07: Extrem milder Winter.
Der Winter 2006/2007 war in Mitteleuropa außergewöhnlich mild und gilt als einer der wärmsten Winter in der jüngeren Geschichte. Die Durchschnittstemperaturen lagen deutlich über dem langjährigen Mittel. In vielen Regionen Mitteleuropas, einschließlich Deutschland, Österreich und der Schweiz, waren die Temperaturwerte im Januar 2007 teilweise 5–7 °C höher als der Durchschnitt. Beispielsweise verzeichnete Deutschland eine Anomalie von +6,5 °C im Vergleich zum Referenzzeitraum 1961–1990.
Niederschlag: Der Winter war nicht nur mild, sondern auch nass. Es gab häufig Regen statt Schnee, selbst in höheren Lagen, was zu einem deutlichen Schneemangel in den Alpen und Mittelgebirgen führte.
Vegetation: Aufgrund der hohen Temperaturwerte begann die Vegetation ungewöhnlich früh. In vielen Regionen blühten Pflanzen bereits im Januar, und die Landwirtschaft war von einem frühen Vegetationsstart betroffen.
Wetterereignisse: Der Winter wurde von starken atlantischen Tiefdrucksystemen geprägt, die milde und feuchte Luftmassen nach Mitteleuropa brachten. Besonders der Sturm „Kyrill“ im Januar 2007 war ein markantes Ereignis, das schwere Schäden verursachte.
Vergleich mit anderen Wintern:
Winter 1989/1990: Ebenfalls sehr mild, aber weniger extrem als 2006/2007. Die Temperaturanomalien waren geringer, und es gab mehr Schneefälle in höheren Lagen.
Winter 2019/2020: Dieser Winter war in vielen Regionen ebenfalls extrem mild, kommt jedoch nicht ganz an den Winter 2006/2007 heran. Er war zudem auch trockener als 2006/2007.
Winter 1974/1975: Ein weiterer milder Winter, aber mit mehr regionalen Unterschieden und kälteren Phasen als 2006/2007.
Der Winter 1185/86 gilt aufgrund der extremen phänologischen Berichte als der mildeste in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre, vor 1538/39. -
2007: Regensommer.
Der Sommer 2007 war ein kühler und sehr nasser Sommer in Deutschland, mit einer Durchschnittstemperatur von ca. 16,0 °C und überdurchschnittlichen Niederschlägen, die lokale Überschwemmungen verursachten. Im Vergleich zu anderen Regensommern war er weniger extrem als 1816 oder 1845, die katastrophale sozioökonomische Folgen hatten, aber nasser und mit mehr Überschwemmungen als 1974 oder 1980. Landwirtschaftliche Auswirkungen waren spürbar, aber nicht dramatisch, und die kühle, feuchte Witterung prägte die öffentliche Wahrnehmung als enttäuschender Sommer. Im Gegensatz zu 1974 fehlte ein kulturelles Symbol („Wann wird es mal wieder richtig Sommer?“), aber die Überschwemmungen machten 2007 in einigen Regionen besonders denkwürdig.
-
2008/09 bis 2012/13 (mehrere kalte und schneereiche Winter):
Die Winter 2008/09 bis 2012/13 bilden eine seltene Abfolge von kalten und schneereichen Wintern in Mitteleuropa. Sie waren kälter und schneereicher als die meisten Winter der 1990er und 2000er, aber deutlich milder als historische Extremwinter wie 1708/09, 1740 oder 1962/63. Die Serie hatte spürbare Auswirkungen auf Verkehr, Energieverbrauch und Tourismus, ohne jedoch die gesellschaftlichen Krisen früherer Jahrhunderte auszulösen. Sie bleibt ein interessantes Beispiel für die Variabilität des Klimas im Kontext der globalen Erwärmung.
Die Häufung wird auf eine negative NAO-Phase zurückgeführt, die kalte Ostwinde und meridionale Zirkulationen begünstigte. Zudem spielte die Arktische Oszillation (AO) eine Rolle, die in dieser Periode oft negativ war und kalte Luft nach Süden lenkte. Die Winter waren nicht nur kalt, sondern auch schneereich, was in tieferen Lagen Mitteleuropas (z. B. Norddeutsches Tiefland) selten ist. Im Dezember 2010 und März 2013 wurden oft 30 bis 50 cm Schnee in Nordostdeutschland gemessen. Dies lag an feuchten Luftmassen, die mit den kalten Ostwinden kollidierten und starke Schneefälle auslösten. Diese Jahre fielen in ein solares Minimum (24. Zyklus), das möglicherweise die globale Abkühlung verstärkte, obwohl der Effekt auf regionale Winter begrenzt ist.Die Abfolge von fünf kalten Wintern von 2008/09 bis 2012/13 ist zwar signifikant, aber nicht einzigartig in der Geschichte Mitteleuropas. Ähnliche Sequenzen traten im 14. Jahrhundert (1303–1328), im 15. Jahrhundert (1430er Jahre) und im frühen 19. Jahrhundert (1808/09–1815/16) auf. Diese Perioden sind durch historische Klimadaten und Studien gut dokumentiert und zeigen, dass solche Kälteperioden, obwohl seltener geworden, Teil der natürlichen Klimavariabilität sind.
-
2010 (Dezember): Extrem viel Schnee und Nord- und Ostdeutschland.
Die Schneehöhe von 50 cm im Tiefland Nordostdeutschlands im Dezember 2010 war historisch gesehen ein sehr seltenes Ereignis, vergleichbar mit den extremsten Wintern des 20. Jahrhunderts wie 1962/63 (40–50 cm) und 1978/79 (40–60 cm). Im Vergleich zu den Jahrtausendwintern 1708/09 und 1740 war 2010 schneereicher im Tiefland, aber weniger kalt. Innerhalb der Serie 2008/09–2012/13 war 2010 ein Höhepunkt, der die anderen Winter in Bezug auf Schneehöhe im Tiefland übertraf.

-
2010 (Dezember): Extreme Kälte in England.
Der Dezember 2010 war in England der zweitkälteste Dezember seit Beginn der Aufzeichnungen der Central England Temperature (CET) im Jahr 1659, nur übertroffen vom Dezember 1890.
Ähnlich kalte oder kältere Dezembermonate fanden sich in:
1890: Kälter als 2010, mit einer CET von -0,8 °C.
1708: Ähnlich kalt, mit einer CET um 0 °C, gefolgt von noch extremerer Kälte im Januar 1709.
1564 und 1432: Vermutlich kälter, aufgrund von historischen Berichten und Proxy-Daten, aber ohne genaue Messungen schwer zu quantifizieren.
Andere Dezembermonate wie 1878, 1796 und 1676 waren ebenfalls sehr kalt, aber weniger extrem als 2010. -
2010 (die meisten Eistage in Berlin seit vielen Jahrzehnten)
Bedingt durch den kalten Winter 2009/2010 und den ungewöhnlich schneereichen und kalten Dezember 2010 weist das Kalenderjahr 2010 die meisten Eistage (Tageshöchsttemperatur <0,0°C) seit vielen Jahrzehnten in Berlin-Dahlem auf. Seit mindestens 1952 gab es kein Jahr mit mehr Dauerfrosttagen in Berlin. (Klimadaten Berlin-Dahlem)
-
2010 (Mai): Verheerende Überschwemmungen im östlichen Mitteleuropa.
Die Mitteleuropäischen Überschwemmungen von 2010 waren eine der schwerwiegendsten Naturkatastrophen in der Region, insbesondere in Polen, wo sie als die schlimmste Katastrophe der letzten 160 Jahre beschrieben wurden. Die Hochwasserereignisse im Frühjahr 2010 wurden durch das Tiefdruckgebiet „Yolanda“ ausgelöst, das sich am 14. Mai 2010 über Nordafrika bildete und über das Mittelmeer nach Mitteleuropa zog. Es blieb mehrere Tage stationär über der Ukraine, bevor es sich nordwestwärts verlagerte, und führte zu extremen Niederschlägen und Sturmböen in Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Österreich und Serbien. Besonders betroffen waren Nordmähren und Schlesien in Tschechien, Schlesien in Polen, die Ostslowakei, Nordungarn sowie Teile Ostösterreichs und Serbiens. Mindestens 29 Menschen starben in den sechs Ländern, und die wirtschaftlichen Schäden beliefen sich auf Milliarden Euro, wobei Polen und Tschechien die höchsten Verluste verzeichneten.
Die Fluten wurden durch eine Vb-Wetterlage verursacht, bei der warme, feuchte Luftmassen aus dem Mittelmeerraum auf kältere Luft in Mitteleuropa trafen. Diese Wetterlage führte zu tagelangem Dauerregen und Sturmböen. Die Böden waren durch vorherige Regenfälle bereits gesättigt, was die Überschwemmungen verschärfte.
Die Fluten von 2010 waren in Polen eine beispiellose Katastrophe, vergleichbar mit dem Oderhochwasser 1997, aber mit geringeren Todeszahlen als historische Sturmfluten wie die Weihnachtsflut 1717 oder die Magdalenenflut 1342. Im Vergleich zu diesen älteren Fluten waren die Opferzahlen 2010 dank moderner Frühwarnsysteme und Evakuierungen deutlich niedriger, die wirtschaftlichen Schäden jedoch höher aufgrund der dichteren Besiedlung und moderner Infrastruktur. Gegenüber den Hochwassern von 2002 und 2013 waren die Fluten von 2010 weniger schwerwiegend in Bezug auf Schäden, aber die geografische Ausdehnung (sechs Länder) und die Intensität in Polen machten sie zu einer der schlimmsten Katastrophen der Region. -
2013 (Mai/Juni): Jahrhundert-Hochwasser.
Ende Mai bis Anfang Juni 2013 ereignete sich ein extremes Hochwasser in Mitteleuropa, besonders in Deutschland, Österreich, Tschechien und der Schweiz. Starke Regenfälle führten zu Rekordpegelständen an Flüssen wie Elbe, Donau und Inn. Passau stand unter Wasser, und in Deutschland wurde in 55 Landkreisen Katastrophenalarm ausgelöst. Es war das schwerste Hochwasser seit 2002, mit geschätzten Schäden von über 12 Milliarden Euro. Die Regenmengen waren durch eine blockierte Wetterlage (negativer Nordatlantik-Oszillationsindex) extrem.
-
2017 (April): Extremer Spätfrost in Mitteleuropa.
Um den 19.–21. April zog eine Kaltfront über Mitteleuropa, die Tagestemperaturwerte von teils über 20 °C auf Nachtwerte zwischen -2 °C und -8 °C absinken ließ. Besonders betroffen waren Deutschland, Frankreich, Österreich, die Schweiz und Norditalien.
Die Spätfröste von 2017 gelten als eine der schlimmsten Frostkatastrophen für die Landwirtschaft in Mitteleuropa seit Jahrzehnten. In Deutschland wurden in einigen Regionen (z. B. Pfalz, Baden, Franken) bis zu 80–100 % der Wein- und Obsternte zerstört. Besonders betroffen waren Rebsorten wie Riesling und Spätburgunder sowie Obstkulturen wie Äpfel und Kirschen. In Frankreich (z. B. Bordeaux, Champagne) wurden historische Ernteverluste verzeichnet, was zu einem Anstieg der Weinpreise führte.
Die Intensität und das Ausmaß der Schäden machten 2017 besonders bemerkenswert. Der Frost traf viele Regionen in einer kritischen Phase der Vegetation (Blüte oder Austrieb), und die Kälte war ungewöhnlich stark und langanhaltend. Zudem war der Kontrast zwischen den warmen Tagen zuvor und den plötzlichen Frosttagen extrem, was die Schäden verstärkte.
Bereits 2016 gab es im April Spätfröste, aber nicht so extrem wie 2017. In beiden Fällen begann die Vegetationsentwicklung nach milden Wintern und mildem Frühlingsbeginn vorzeitig. Die Spätfröste 2017 waren noch deutlich schwerwiegender als 2016, sowohl in Bezug auf die Intensität der Kälte als auch auf die wirtschaftlichen Schäden. 2017 wird oft als „Jahrhundertfrost“ bezeichnet, da die Schäden in einigen Regionen historisch waren. -
2018 (Februar/März): „The Beast from the East“.
Der Kaltluftvorstoß im Februar und März 2018, bekannt als „The Beast from the East“, war ein außergewöhnliches Wetterereignis. Eine starke Kaltluftmasse aus Sibirien, verstärkt durch ein stabiles Hochdruckgebiet über Skandinavien, brachte extrem niedrige Temperaturwerte nach Mittel- und Westeuropa. Selbst Regionen wie Großbritannien, Frankreich und Südeuropa, die normalerweise mildere Winter haben, waren betroffen. Temperaturwerte fielen teilweise auf Werte, die seit Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurden.
Das Ereignis wurde durch eine sogenannte „Sudden Stratospheric Warming“ (plötzliche Stratosphärenerwärmung) ausgelöst, die den Polarwirbel schwächte und kalte Luftmassen nach Süden lenkte. Solche Ereignisse sind relativ selten und führen oft zu extremen Wetterlagen.
Der Kaltluftvorstoß brachte starke Schneefälle, Verkehrschaos, Schließungen von Schulen und Unternehmen sowie zahlreiche Todesfälle durch die Kälte. In Großbritannien wurde ein „Red Weather Warning“ ausgegeben, was sehr selten ist. In Osteuropa waren die Bedingungen noch extremer, mit Temperaturwerte teilweise unter -20 °C.
Kurz nach dem ersten Kaltluftvorstoß traf der Sturm „Emma“ auf die kalte Luft, was zu heftigen Schneestürmen und Blizzard-Bedingungen in Teilen Westeuropas führte, insbesondere in Irland und Großbritannien. Das Ereignis fand Ende Februar bis Anfang März statt, was für so extreme Kälte ungewöhnlich spät in der Wintersaison ist. Viele Regionen hatten bereits mit dem Frühling gerechnet. -
2018: Außergewöhnlich heißer und trockener Sommer in Deutschland,
er war einer der extremsten Hitzesommer, nur knapp hinter 2003 (Hitze) und 2022 (europaweite Intensität). Seine Trockenheit war nahezu beispiellos, vergleichbar nur mit 1540 (historisch) und 2022 (modern). Die langanhaltende Dürre von April bis Oktober und die weitreichenden ökologischen und wirtschaftlichen Folgen machen 2018 zu einem „Jahrhundertsommer“.
Der Sommer 2018 war der zweitwärmste in Deutschland seit 1881 (Durchschnittstemperatur ca. 19,3 °C, etwa 1,5 °C über dem langjährigen Mittel). Es gab 75 Sommertage (≥25 °C) und über 20 Hitzetage (≥30 °C), beides Rekordwerte. In einigen Regionen (z. B. Hamburg, Berlin) waren die Temperaturwerte vergleichbar mit südeuropäischen Städten wie Bordeaux oder Nizza.
Niederschläge: Mit nur 263 Litern pro Quadratmeter (April–September) war 2018 einer der trockensten Sommer, nur 1911 war trockener (249 l/m²). In Norddeutschland begann die Dürre bereits im April, während Süddeutschland teilweise von Gewittern profitierte. Bis Oktober herrschte in 70 % Deutschlands extreme Trockenheit, besonders in tieferen Bodenschichten.
Auswirkungen: Massive Ernteausfälle (z. B. Getreide, Raps), Waldbrände, historische Niedrigwasserstände (Rhein, Elbe), (mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„) Lieferengpässe in der Binnenschifffahrt und etwa 8.700 hitzebedingte Todesfälle in Deutschland. Bäume litten unter Trockenstress, was die Borkenkäferplage verschärfte.
Der Sommer 2018 begann bereits im April mit Rekordtemperaturwerten und erstreckte sich bis in den Herbst. Ein stabiles Hochdruckgebiet (Omegahoch) und ein geschwächter Jetstream führten zu langanhaltender Hitze und Trockenheit.
Vergleich mit anderen Hitzesommern:
Hitze (Deutschland): 2003 (19,6 °C) > 2019 (19,7 °C) > 2018 (19,3 °C) > 2022 (19,2 °C). 1540 ist nicht exakt vergleichbar, war aber vermutlich ähnlich extrem oder noch heißer.
Trockenheit (Deutschland): 2018 ≈ 2022 (263 bzw. 104 l/m², aber 2022 kürzer) > 2003 > 2019. 1540 war vermutlich die extremste Dürre.
Auswirkungen: 2003 hatte europaweit die schwersten Folgen (Todeszahlen, Gletscherverluste). 2018 und 2022 waren in Deutschland vergleichbar extrem (Niedrigwasser, Ernteausfälle). 2019 war weniger intensiv. 1540 hatte die schlimmsten historischen Folgen (Hungersnöte).
Meteorologische Besonderheiten: 2018 und 2022 zeichneten sich durch langanhaltende Hochdrucklagen und geschwächte Jetstreams aus. 2003 war durch eine extreme Hitzeperiode geprägt,
Beim Jahrtausendsommer 1540 gab es keine exakten Messungen, aber Berichte deuten auf extreme Hitze hin, vergleichbar oder heißer als 2003. Zeitzeugen berichteten von Temperaturwerten, die Ernten verdorren ließen. Zudem war es extrem trocken, mit elf Monaten fast ohne Niederschlag. Flüsse wie Rhein und Elbe waren zu Fuß passierbar, was 2018 nicht der Fall war. Dazu massive Ernteausfälle, Hungersnöte, Wald- und Buschbrände. Die Dürre war so extrem, dass 1540 als „Jahrtausendsommer“ gilt.

-
2019: Hitzesommer.
Der Sommer 2019 war der drittwärmste seit 1881, nur knapp hinter 2018 (19,3 °C) und 2003 (19,67 °C). Er stach durch neue Temperaturrekorde und extreme Hitzewellen heraus, war aber weniger trocken als 2018 und 2003. Im historischen Vergleich war 1540 katastrophaler, während 1947 bei Sonneneinstrahlung 2019 übertraf.
-
2019/2020: Extrem milder Winter.
Der Winter 2019/2020 in Mitteleuropa war außergewöhnlich mild und gehört zu den wärmsten Wintern in der meteorologischen Geschichte der Region. Der Winter 2019/2020 war geprägt von deutlich überdurchschnittlichen Temperaturwerten. In vielen Teilen Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Schweiz, etc.) lagen die Durchschnittstemperaturen 2 bis 3 °C über dem langjährigen Mittel (z. B. 1961–1990).
In Deutschland war der Winter 2019/2020 der zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen 1881, mit einer Durchschnittstemperatur von etwa 4,2 °C (nur der Winter 2006/2007 war wärmer mit 4,4 °C).
Es gab kaum anhaltende Kälteperioden. Frosttage waren selten, und Schneefall blieb in tieferen Lagen weitgehend aus.
Vergleich mit historischen Wintern:
Winter 1974/1975: Ein sehr milder Winter im 20. Jahrhundert, mit Temperaturwerten, die regional etwa 1–2 °C über dem Durchschnitt lagen. Im Vergleich dazu war 2019/2020 noch wärmer.
Winter 2006/2007: Der bisher wärmste Winter in Deutschland (ca. 4,4 °C). Der Winter 2019/2020 war nur geringfügig kälter, liegt aber in derselben Kategorie extremer Wärme.
Winter 1795/1796: Einer der mildesten Winter des 18. Jahrhunderts in Mitteleuropa, mit kaum Frost und wenig Schnee. Die damaligen Temperaturwerte waren jedoch vermutlich kälter als 2019/2020, da die globale Erwärmung noch keine Rolle spielte.
Der Winter 1185/86 gilt aufgrund der extremen phänologischen Berichte als der mildeste in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre, vor 1538/39. -
2020 (November): Anfang November erreicht tropische Meeresluft (Luftmasse mT) Europa
(extrem seltenes Ereignis).
Deutschland: In Rheinfelden (Baden-Württemberg) wurden am 2. November 26,0 °C gemessen – einer der wärmsten Novembertage überhaupt in Deutschland. Schweiz: Genf meldete 23,9 °C, was für Anfang November extrem hoch ist. Österreich: In Teilen Kärntens und der Südsteiermark wurde die 25 °C-Marke erreicht – ebenfalls rekordverdächtig. Frankreich: Temperaturwerte bis zu 29 °C in Teilen Südwestfrankreichs. Polen und Tschechien: Örtlich über 20 °C, ungewöhnlich für Anfang November.
-
2020/2021: Extreme Kälte in Spanien.
Dieser Winter wurde durch das Sturmtief „Filomena“ geprägt, das außergewöhnlich kalte Temperaturwerte und heftige Schneefälle brachte. Am 6. Januar 2021 wurde in der Station Clot del Tuc de la Llança (Pyrenäen) eine Temperatur von -34,1 °C gemessen, die als die niedrigste je in Spanien aufgezeichnete Temperatur gilt. Am 7. Januar 2021 wurde in Vega de Liordes (Picos de Europa) sogar -35,6 °C gemessen, allerdings ist dies kein offizieller Rekord des staatlichen Wetterdienstes AEMET. Am 12. Januar 2021 sanken die Temperaturwerte in der Region des sogenannten „Kältedreiecks“ (Teruel, Molina de Aragón, Calamocha) auf Werte wie -25,4 °C in Bello und -21 °C in Calamocha und Teruel.
Filomena brachte massive Schneefälle, die weite Teile Spaniens, einschließlich der Hauptstadt Madrid, lahmlegten. In Madrid fielen am 9. Januar 2021 bis zu 20 cm Schnee, und die Temperaturwerte sanken in der folgenden Nacht auf bis zu -12 °C. Dies war der schwerste Schneefall in Madrid seit Jahrzehnten. Das Kältedreieck in Zentralspanien, bekannt für extreme Winterkälte, erlebte Temperaturwerte, die seit mindestens 20 Jahren nicht mehr erreicht wurden.
Der Winter 2020/2021 war aufgrund des Sturmtiefs Filomena der extremste in Spanien seit Jahrzehnten. Er brachte rekordverdächtige Tiefsttemperaturwerte (z. B. -34,1 °C) und starke Schneefälle sowohl in Bergregionen als auch in städtischen Gebieten. Im Vergleich zu anderen kalten Wintern wie 1956 war er flächendeckender und störender und betraf dicht besiedelte Regionen. Die Winter 2009/2010, 2010/2011 und 2018 waren kälter als der Durchschnitt, aber weniger extrem, mit weniger tiefen Temperaturwerte und weniger einschneidendem Schnee. Filomenas Kombination aus intensiver Kälte, starkem Schneefall und weitreichender geografischer Auswirkung macht ihn zu einem einzigartig erinnerungswürdigen Ereignis in der jüngeren Klimageschichte Spaniens. -
2021 (Mai): Schneefall in Berlin am Vormittag des 07. Mai (ohne Schneedecke).
Schneefall in Berlin im Mai ist sehr selten, zuletzt 1982, 1970, 1953, 1928, 1902. Trat während der Kleinen Eiszeit nach den gehäuft strengen Wintern jedoch öfter auf. Zuvor war der April 2021 recht kalt und die Baumbelaubung fand rund zwei bis drei Wochen später als durchschnittlich statt.
Schneefall in Berlin-Zehlendorf am 07. Mai 2021
-
2021 (Juli): Jahrhunderhochwasser im Ahrtal:
Das Ahrtal-Hochwasser im Juli 2021 wurde durch das Tiefdruckgebiet „Bernd“ verursacht, das extreme Regenmengen brachte. Innerhalb von 24 Stunden fielen in Teilen des Ahrtals 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter, teilweise in nur 10 bis 18 Stunden. Diese Niederschläge übertrafen historische Rekorde und führten zu extremen Pegelständen, die alle bisherigen Hochwasser im Ahrtal um ein Vielfaches überstiegen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sprach von einem „Jahrhundertereignis“, das etwa alle 100 Jahre erwartet wird.
Im Vergleich: Das Magdalenenhochwasser 1342 betraf weite Teile Mitteleuropas (Rhein, Donau, Elbe, Moldau, etc.) und war ein kontinentales Ereignis mit einem geschätzten Wiederkehrwert von 10.000 Jahren. Das Ahrtal-Hochwasser war regional begrenzter, hauptsächlich auf Westdeutschland (Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen) fokussiert, und gilt als Jahrhundertereignis (ca. 100 Jahre).
-
2022 Extremer Hitzesommer:
Der Sommer 2022 war in Mitteleuropa der heißeste seit 1881 und gehört zu den heißesten der letzten 2000 Jahre. Er übertrifft moderne Sommer wie 2003 und 2018 minimal in der Hitze und ist deutlich heißer als Sommer im Mittelalterlichen Klimaoptimum oder der Kleinen Eiszeit (außer 1540). Die Trockenheit war extrem, aber nicht so anhaltend wie 1540.
Der Sommer 2022 zeichnete sich durch extreme Hitzewellen, Temperaturwerte über 40 °C in mehreren Regionen und eine ausgeprägte Dürre aus, die zu Waldbränden, Ernteverlusten und Niedrigwasser (mehr dazu im Artikel „Ausgetrocknete Flüsse Mitteleuropa„) führte. In Deutschland war 2022 einer der vier wärmsten Sommer seit 1881, mit Temperaturwerte von bis zu 40 °C (z. B. in Barsinghausen-Hohenbostel) und einer Rekordsonneneinstrahlung von 790 Stunden im Mittel.
In der Gesamtkombination Hitze, Trockenheit, Andauer und räumliche Ausdehnung belegt der Sommer 2022 vermutlich Platz 3 der Hitliste der Sommer in Mitteleuropa. -
2024 (Januar): Extreme Kältewelle Skandinavien.
Im Januar 2024 erlebte Oslo eine extreme Kältewelle, bei der ein neuer Temperaturrekord aufgestellt wurde. In Bjørnholt, im Norden der Stadt, wurde in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar 2024 eine Temperatur von -31,1 °C gemessen. Dies war die niedrigste Temperatur in Oslo seit Beginn der Aufzeichnungen, also seit über 150 Jahren. Im Stadtzentrum von Oslo sanken die Temperaturwerte in derselben Nacht auf bis zu -21,5 °C. Diese Kältewelle betraf nicht nur Oslo, sondern auch andere Teile Nordeuropas, wie Nordschweden, wo ebenfalls extreme Minusgrade verzeichnet wurden. Die extreme Kälte führte zu erheblichen Herausforderungen, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr. Beispielsweise waren die Batterien von elektrischen Stadtbussen in Oslo bei diesen Temperaturwerte nicht funktionsfähig, weshalb sie durch Dieselbusse ersetzt werden mussten. Zudem gab es Berichte über beeindruckende Naturphänomene wie arktische Seerauchbildung im Hafen von Oslo aufgrund der extremen Kälte.
-
2024: Wärmstes Jahr und Frühjahr in Deutschland
seit Beginn der Messungen, mit einer Mitteltemperatur von 10,9 °C. Der März 2024 war der wärmste seit 2017. Die Blüte der Forsythie begann rund vier Wochen früher, die Baumbelaubung fand rund zwei bis drei Wochen früher als durchschnittlich statt.
Die gemittelten Jahresmitteltemperaturen für Paris, Berlin, Warschau, Kopenhagen, Wien, Zugspitze und Brocken ergaben einen Wert von 9,1°C, im Vergleich zu 5,9°C im kältesten Jahr 1940. -
2024 (September). Schwere Überflutungen im südöstlichen Mitteleuropa.
Im September 2024 führte das Sturmtief „Boris“ zu katastrophalen Überschwemmungen in Mitteleuropa, insbesondere in Polen, Tschechien, Österreich und der Slowakei. Niederschläge von bis zu 420 l/m² innerhalb von 48 Stunden wurden an der Grenze zwischen Polen und Tschechien verzeichnet, in den Alpen (Nordstau) bis zu 350 l/m². Diese Mengen entsprechen mehreren Monatsniederschlägen in wenigen Tagen. Die Fluten verursachten Schäden von etwa 2,2 Mrd. € (versichert) und betrafen etwa zwei Millionen Menschen in der Region. Es gab mindestens 32 Todesopfer durch Flutereignisse in Mitteleuropa.
Hochwasserereignisse wie die Marcellusflut von 1219 (36.000 Tote) oder die Magdalenenflut von 1342 (eine der schlimmsten Fluten in Mitteleuropa) waren in ihrer Zerstörungskraft und Opferzahl dramatischer. Dennoch war die Intensität der Niederschläge 2024 (420 l/m² in 48 Stunden) außergewöhnlich und vergleichbar mit modernen Katastrophen wie der Ahr-Flut 2021.
Der starke Schneefall in höheren Lagen Mitteleuropas im September 2024, der gleichzeitig zu den Fluten durch Sturmtief „Boris“ im Tiefland auftrat, war für September zwar bemerkenswert, aber nicht historisch extrem oder beispiellos. -
2024/2025: Mildester Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Der Jahreswechsel 2024/2025 war in Mitteleuropa der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit Temperaturwerten bis zu 18 °C in Städten wie Dresden und Baden-Baden, etwa 2 °C höher als bei früheren milden Wetterlagen um den Jahreswechsel (z. B. 1925, 1991 und 2022/2023).
-
2025 (März): Niedrigste maximale Wintereis-Ausdehnung in der Arktis
seit mindestens 45 Jahren. (Max- und Min-Eis-Ausdehnung letzte Jahrzehnte)
-
2025 (Mai): Extremer Spätfrost in den östlichen Mittelgebirgen.
-
2025 (Frühjahr): Sehr trockenes und sonniges Frühjahr
Extreme Trockenperioden sind in der Geschichte Mitteleuropas dokumentiert, etwa die Dürre von 1198, die 15 Wochen andauerte, oder die Hitzewelle von 1540, die als „Jahrtausenddürre“ bekannt ist. Die Trockenheit vom Frühjahr 2025 war regional begrenzter und weniger langanhaltend, war aber im historischen Vergleich durchaus signifikant, insbesondere da sie mit Rekordsonneneinstrahlung einherging.
-
2025 (Monatswechsel Juni/Juli): Extreme Hitzewelle in Südwesteuropa.
Afrikanische Tropikluft (Luftmasse cT), auch als Saharaluft bekannt, sorgt in Spanien, Frankreich und Teilen Deutschlands für Temperaturwerte von 35 bis 40°C, teilweise darüber (Spanien, Mittel- und Südfrankreich). Die Hitzewelle 2025 ist extrem, insbesondere durch ihr frühes Auftreten im Juni und die hohen Temperaturwerte, die lokal Rekordwerte von 2019 übertreffen könnten. Sie ist jedoch nicht beispiellos, da ähnliche Ereignisse in 2003, 2019 und 2022 verzeichnet wurden.
Diese Hitzewelle in Spanien und Frankreich gehört zu den extremsten jemals aufgezeichneten für den Monat Juni und ist nur mit den schwersten Hitzewellen der letzten Jahrzehnte (z. B. 2003, 2019, 2021) vergleichbar. Im historischen Kontext von 2000 Jahren sind derartige Temperaturen (45 °C in Spanien (El Granado), 40 °C in Frankreich) möglicherweise sogar beispiellos für den Frühsommer (1540 oder 1479 fehlen direkte Messungen). Höhere Temperaturen als 2025 wurden in Spanien nur im August 2021 (47,0 °C) und in Frankreich im August 2019 (46,0 °C) gemessen.
Im Gegensatz zur Hitzespitze 1952, wo in Deutschland am Oberrhein lokal 40 °C erreicht wurden, war die Hitzewelle 2025 durch ihre flächendeckende Intensität bemerkenswert (mehrere Messungen mit 39°C, 35°C selbst auf Rügen und Hiddensee).
Die Hitzewelle 2025 führte in Tschechien zu massivem Fischsterben im Modlany-See (nahe der Stadt Ústí nad Labem) durch Sauerstoffmangel aufgrund hoher Wassertemperaturen, mit erheblichen ökologischen und wirtschaftlichen Folgen. In Frankreich und der Schweiz wurden AKWs wie Golfech, Blayais und Beznau heruntergefahren, um Flüsse vor weiterer Erwärmung zu schützen, was die Stromversorgung in Europa beeinträchtigte und die Preise in die Höhe trieb.
Die Hitzewelle im Frühsommer 2025 war extrem, mit einigen lokalen neuen Höchstwerten. Allerdings war sie nicht beispiellos und war etwa auf dem Niveau der Hitzewellen früherer Sommer, wie 2003 oder 2018. Es gibt auch einige Tage nach dem Ereignis nur einzelne Berichte über Hitzeopfer. Da waren bei früheren Hitzeereignissen die Anzahl der Opfer höher, zumal die hohen Temperaturwerte in Mitteleuropa auch nur wenige Tage auftraten.
Mehr zu der Hitzewelle im Frühsommer 2025. August 2025 – rekordverdächtige Hitzewelle in Südfrankreich
Frankreich erlebte im August 2025 eine der intensivsten Hitzewellen der jüngeren Geschichte, die definitiv rekordverdächtig war. Die Hitze war durch ein stabiles Hochdruckgebiet über dem Mittelmeer verstärkt, das heiße afrikanische Luft nach Nordwesteuropa pumpte.Montpellier: 42,8 °C (14. August) – neuer August-Rekord, übertrifft 2003 (42,0 °C). Für August speziell ist 2025 einer der heißesten Monate in Südfrankreich, mit Rückkehrperioden von 50–100 Jahren für solche Peaks. Im Vergleich zu den letzten 2000 Jahren ist diese Hitzewelle nicht absolut beispiellos – Paläoklimastudien (z. B. aus Korallen oder Sedimenten) deuten auf ähnliche oder heißere Sommer in der Römerzeit (ca. 100–400 n. Chr.) oder der Mittelalterlichen Warmzeit hin (bis +1–2 °C regional).-
Jahr 2025 und laufendes Jahr 2026 (wird monatlich aktualisiert)
Abgesehen von den bereits aufgenommenen Highlights in 2025 gab es in Mitteleuropa bislang keine weiteren Wetterereignisse, die als beispiellos oder nahe am Extremum der letzten Jahrhunderte gelten können. Der Dezember 2025 war insgesamt zu mild und zu trocken (trotz der kältesten Weihnachten in Nord- und Ostdeutschland seit 15 Jahren), ohne Extremereignisse. Das Jahr 2025 war insgesamt zu warm, zu trocken und überdurchschnittlich sonnig, allerdings ohne in die Nähe von Extremwerte im Vergleich zu den letzten 2000 Jahren zu kommen.
- Heißeste Sommer: 2003
- Kühlste/verregnetste Sommer: 2007
- Kälteste Winter: 2010/11
- Mildeste Winter: 2006/07
- Hitzewellen und Dürren: Extreme Sommer wie 1540, 1911, 2003 und 2018 zeigen, dass Hitzewellen oft mit stabilen Hochdrucklagen (Omegalagen) verbunden sind, die Niederschläge verhindern. Die Dürre von 1540 bleibt das extremste Ereignis, sowohl in Dauer als auch in Auswirkung.
- Kalte Winter: Die Kleine Eiszeit (ca. 1300–1850) brachte häufig strenge Winter, wie 1607/08, 1708/09, 1739/40, 1829/30 und im Jahrtausend zuvor 763/64. Solche Ereignisse führten oft zu Hungersnöten, da Ernten durch Frost zerstört wurden.
- Schneefälle: Außergewöhnliche Schneehöhen, wie 1988 am Großen Arber und 2010/2013 im Nordostdeutschland sind typisch für Winter mit starken Kaltlufteinbrüchen und hoher Niederschlagsaktivität. Solche Ereignisse sind zwar regional begrenzt, aber von großer lokaler Bedeutung.
- Sturmfluten: Die Nordseeküste war über Jahrhunderte von verheerenden Sturmfluten betroffen (z. B. 1164, 1219, 1570), die durch fehlenden Küstenschutz und den steigenden Meeresspiegel verschärft wurden.
- Klimawandel: Seit dem 19. Jahrhundert zeigt sich eine Zunahme warmer Jahre, besonders seit den 1990er Jahren. Ereignisse wie 2003, 2018 und 2022 könnten Vorboten eines sich verändernden Klimas sein.
- Winter 1072/73: Ebenfalls sehr mild, mit Berichten von ausgetriebenen Bäumen zu Neujahr und Vögeln, die im Februar Junge hatten. Er war ähnlich warm wie 1185/86, aber die phänologischen Berichte sind weniger detailliert.
- Winter 1538/39: In der Schweiz wurden Kirschenernten im Dezember und blühendes Getreide im Januar dokumentiert. Dieser Winter war extrem mild, aber die Berichte deuten darauf hin, dass 1185/86 noch außergewöhnlicher war.
- Winter 2006/07: Mit +4,4 °C der mildeste Winter in Deutschland seit Beginn der Messungen (1881). Er war durch stürmische Westlagen geprägt (z. B. Orkan Kyrill) und hatte kaum Frosttage. Im historischen Vergleich war 1185/86 sehr wahrscheinlich noch milder, da die phänologischen Anomalien (z. B. Baumblüte im Winter) extremer waren als die modernen Beobachtungen von 2006/07.
- Winter 2019/2020: Mit +4,2 °C der zweitwärmste seit 1881, ebenfalls ohne nennenswerte Frosttage. Er war milder als die meisten historischen Winter, aber 1185/86 übertrifft ihn in den Chroniken durch die extremen phänologischen Ereignisse.
-
Sommer 536 (Spätantike Kleine Eiszeit)
-
Beschreibung: Der Sommer 536 gilt als einer der kältesten in den letzten 2000 Jahren, ausgelöst durch einen massiven Vulkanausbruch (möglicherweise in Island oder Nordamerika), der Aerosole in die Atmosphäre schleuderte und die Sonneneinstrahlung blockierte. Chroniken berichten von einem „verhüllten Himmel“, Schnee im Sommer in Südeuropa, und Temperaturwerten, die 1,5–2,5 °C unter dem damaligen Mittel lagen. In Mitteleuropa (z. B. Schweiz, Süddeutschland) wurden Ernteausfälle dokumentiert, die eine Hungersnot einleiteten.
-
Auswirkungen: Diese Kältephase leitete die Spätantike Kleine Eiszeit (ca. 536–660) ein, die mit weiteren Vulkanausbrüchen (z. B. 540, 547) verstärkt wurde.
-
-
Sommer 1315 (Große Hungersnot)
-
Beschreibung: Der Sommer 1315 war extrem kalt und nass, mit Temperaturwerten, die etwa 1–2 °C unter dem Mittel der Kleinen Eiszeit lagen. Anhaltende Regenfälle führten zu Überschwemmungen, und die Kälte verzögerte das Pflanzenwachstum. In Chroniken wird von „ewigem Regen“ und Frost im Juni berichtet.
-
Auswirkungen: Dieser Sommer war Teil einer Serie kalter, nasser Jahre (1315–1321), die die Große Hungersnot auslösten. Ernteausfälle führten zu Millionen Toten in Europa.
-
-
Sommer 1816 („Jahr ohne Sommer“)
-
Beschreibung: Der Sommer 1816 war der kälteste der modernen Ära, mit Temperaturwerte in Mitteleuropa etwa 2–3 °C unter dem Mittel (ca. 13 °C statt 16 °C). Der Ausbruch des Vulkans Tambora (1815) in Indonesien verursachte eine globale Abkühlung durch Aerosole. In Deutschland schneite es im Juni (z. B. Bayern), und es gab Frost im Juli.
-
Auswirkungen: Ernteausfälle führten zu Hungersnöten, besonders in Süddeutschland und der Schweiz. Brotpreise verdreifachten sich, und es kam zu sozialen Unruhen.
-
-
Kälteste Sommer im Vergleich: 536 war der extremste durch die vulkanische Abkühlung, gefolgt von 1816 (ebenfalls vulkanisch bedingt) und 1315 (klimatische Instabilität am Übergang zur Kleinen Eiszeit). Sommer wie 1675 (ebenfalls kalt, ca. −1,5 °C unter dem Mittel) oder 1725 waren ebenfalls kühl, aber weniger extrem dokumentiert.
-
Nasseste Sommer im Vergleich: 1315 und 1342 waren historische Höhepunkte in Bezug auf Niederschlag und Überschwemmungen. 2013 zeigt, dass solche Ereignisse auch in der Moderne auftreten können, oft durch ähnliche Wetterlagen (Vb-Lagen). Sommer wie 1529 (ebenfalls nass, mit Überschwemmungen in Süddeutschland) oder 1768 waren ebenfalls nass, aber weniger verheerend.
-
Kombination von Kälte und Nässe: 1315 sticht heraus, da Kälte und Nässe kombiniert die schlimmsten Auswirkungen hatten. 1816 war kälter, aber weniger nass, während 1342 extrem nass, aber nicht so kalt war.
- Historische Chroniken (z. B. 1540) können übertreiben oder subjektiv sein, aber die Konsistenz über viele Quellen hinweg (mehr als 300 für 1540) erhöht die Glaubwürdigkeit.
- Dendrochronologie (Baumringe) liefert widersprüchliche Ergebnisse für 1540, da Hitzestress das Baumwachstum stoppen kann, was die Rekonstruktion erschwert.
- Moderne Messungen (ab 1761) sind zuverlässiger, aber regionale Unterschiede können die Interpretation beeinflussen. Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa ist eine flächenmäßige Betrachtung und einzelne Wetterstationen können bei der Rangfolge andere Platzierungen belegen.
- Sonnenstrahlung: Die Intensität und Verteilung der Sonneneinstrahlung (z. B. durch Erdachse, Umlaufbahn, Sonnenzyklen) bestimmen die Energie, die das Klimasystem antreibt.
- Atmosphärische Zusammensetzung: Treibhausgase wie CO₂, Methan und Wasserdampf speichern Wärme (Treibhauseffekt). Aerosole und Schadstoffe können die Strahlung reflektieren oder absorbieren.
- Ozeanzirkulation: Meeresströmungen wie der Golfstrom verteilen Wärme und Feuchtigkeit global, z. B. mildern sie das Klima in Westeuropa.
- Landoberfläche: Albedo (Reflexionsvermögen) von Eis, Wäldern oder Wüsten beeinflusst die Wärmeaufnahme. Entwaldung oder Urbanisierung verändern das lokale Klima.
- Vulkanismus: Vulkanausbrüche schleudern Partikel in die Atmosphäre, die kurzfristig (Monate oder wenige Jahre) abkühlen können (z. B. durch Schwefeldioxid).
- Menschliche Aktivität: Verbrennung fossiler Brennstoffe, Abholzung, Landwirtschaft und Industrie erhöhen Treibhausgase und verändern Landnutzung. Vor allem der Anteil dieses Faktors ist derzeit Bestandteil der häufigen Diskussionen („menschengemachter Klimawandel“).
- Natürliche Schwankungen: Phänomene wie El Niño/La Niña (ENSO) oder die Nordatlantische Oszillation (NAO) beeinflussen regionale Klimamuster.
- Aus sehr langfristiger Sicht hat die Lage der Kontinente einen erheblichen Einfluss auf das Klima der Erde, vor allem über Zeiträume von Millionen Jahren. Hier die gesamte Klimahistorie der Erde mit Schwerpunkt auf den Grad der Vereisung der Erde.
- Anmerkungen und Kommentare zu dieser Seite können im zugehörigen Blog-Artikel auf schneedecke.de hinterlassen werden.
- Weitere Links:
Bisherige Rekordsommer und Rekordwinter des 21.Jahrhundert in Mitteleuropa
(Stand 2025)
Kurz-Zusammenfassung dieser Chronik (18.08.2025)
Analyse und Muster
Was waren die kältesten/extremsten Winter der letzten Jahrhunderte?
Da die kältesten Winter der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa nicht durch Messwerte, sondern indirekt dokumentiert wurden, gibt es keine feststehende Rangliste. Je nach Priorität oder Perspektive ergeben sich andere Ranglisten der strengsten/härtesten Winter der letzren 2000 Jahre. Eine Top5 oder Top 10 ist schon eher möglich. Kriterien wie „komplette Ostsee vereist“ oder „alle großen Flüsse zugefroren„, „Ausdehnung nach Südeuropa“ oder „Winter-Opfer“ ergeben neben den historische Chroniken und naturwissenschaftliche Rekonstruktionen (z. B. Dendrochronologie) jeweils nur Indizien. Zumal es auch andere regionale Schwerpunkte innerhalb Europas geben kann. Mit den derzeitigen Text/Sprach-KI’s habe ich jeweils unterschiedliche Fragestellungen und Prioritäten durchgesprochen und die Ergebnisse mit weiteren Verlinkungen stelle ich jedem Interessierten Winterfreund (mit der Option der eigenen weiteren Recherche) hier zur Verfügung: Die kältesten Winter in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre.
Was waren die heißesten/extremsten Sommer der letzten Jahrhunderte?
Beschreibung jeweils weiter oben in der chronologischen Auflistung. Die Reihenfolge kann nicht als absolut angesehen werden, da sie ein Durchschnitt von Mitteleuropa sind und frühere Jahre nicht mit Temperaturmessungen unterlegt sind, sondern die Auswirkungen indirekt dokumentiert wurden.
Der Sommer 1540 ( Weitere Details zum Hitzesommer 1540) war vermutlich der heißeste und trockenste Sommer der letzten 2000 Jahre in Mitteleuropa. Kein anderer Sommer in diesem Zeitraum scheint die Kombination aus extremen Temperaturwerten, anhaltender Dürre und gesellschaftlichen Auswirkungen in gleichem Maße erreicht zu haben. Moderne Sommer wie 2022, 2003 und 2018 kommen der Intensität von 1540 nahe, aber Rekonstruktionen deuten darauf hin, dass 1540 extremer war, insbesondere in Bezug auf die Dürre. Baumringe und andere Rekonstruktionen (z. B. Wetterauer et al., 2014) zeigen eine außergewöhnliche Anomalie für 1540, die in den letzten 2000 Jahren kaum Parallelen hat.
Weitere Details im Artikel: Heißeste Sommer Mitteleuropa – ein historischer Rückblick der letzten 2000 Jahre!
Über die heißesten Sommer und strengsten Winter der letzten 2000 Jahre (so weit überliefert) habe ich nun ausführlich gesprochen. Jetzt fehlen noch die mildesten Winter und kältesten Sommer in der Übersicht, sie tauchen ebenfalls weiter oben in der chronologischen Übersicht auf.
Was waren die mildesten Winter der letzten Jahrhunderte?
Der mildeste Winter in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre wird häufig als der Winter 1185/86 angesehen, basierend auf historischen Chroniken und vor allem aufgrund von phänologischen Beobachtungen.
Chroniken, insbesondere aus der Schweiz, berichten von außergewöhnlicher Milde. Im Januar blühten Bäume, im Februar wuchsen haselnussgroße Äpfel, im Mai wurde Getreide geerntet, und im August gab es bereits Wein – ein extrem ungewöhnliches phänologisches Ereignis. Temperaturwerte wurden nicht gemessen, aber solche Beobachtungen deuten auf ein Jahreszeitenmittel von möglicherweise +5 bis +6 °C über dem Mittel der Kleinen Eiszeit hin (ca. 0 °C für den Winter). Dieser Winter fiel in das Mittelalterliche Klimaoptimum (ca. 950–1250), eine Phase mit generell wärmeren Temperaturwerten, die Landwirtschaft und Weinbau in höheren Breiten begünstigte.
Vergleich mit anderen milden Wintern
Der Winter 1185/86 gilt aufgrund der extremen phänologischen Berichte als der mildeste in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre, vor 1538/39. Während moderne Winter wie 2006/07 (+4,4 °C), 2019/20 (+4,2 °C) und 1989/90 (+4,1 °C) die wärmsten gemessenen sind, deuten die historischen Beschreibungen von 1185/86 oder 1538/39 auf eine noch ungewöhnlichere Milde hin, die in einem kälteren Klimakontext (Mittelalterliches Klimaoptimum) stattfand.
Die Rangliste der mildesten Winter in Mitteleuropa über die letzten 2000 Jahre, basierend auf Beschreibungen, Chroniken und Proxy-Daten, bestätigt den Winter 1185/86 als den außergewöhnlichsten aufgrund seiner extremen phänologischen Anomalien (Baumblüte im Januar, Obstbildung im Februar, Weinlese im August), unterstützt durch Proxy-Daten. Der Winter 1538/39 folgt mit frühen Blüten und starker Proxy-Unterstützung. Die modernen Winter 2006/07 und 2019/20 sind sehr mild, aber ihre phänologischen Anomalien sind weniger extrem, obwohl sie durch Proxy-Daten und Messdaten gut dokumentiert sind.
Solche Ereignisse waren oft durch starke West- bis Südwestlagen und fehlende Kaltlufteinbrüche aus Nord bis Ost bedingt, was auch moderne milde Winter prägt.
Was waren die kältestens Sommer der letzten Jahrhunderte?
Die kältesten und nassesten Sommer in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre hatten oft erhebliche Auswirkungen, insbesondere durch Ernteausfälle und Hungersnöte. Im Folgenden liste ich die markantesten Beispiele auf.
Kälteste Sommer in Mitteleuropa
Einordnung im Vergleich zu anderen Sommern
Der Sommer 536 war der kälteste aufgrund vulkanischer Einflüsse, gefolgt von 1816 und 1315, die beide katastrophale Folgen hatten. Der nasseste Sommer war 1315, dicht gefolgt von 1342, mit 2013 als modernem Vergleich. Diese Sommer zeigen, wie stark klimatische Anomalien (Vulkanismus, Wetterlagen) das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen können, mit oft verheerenden Folgen für die Landwirtschaft und Gesellschaft. Mehr zu den kältesten und nassesten Sommern in Mitteleuropa der letzten 2000 Jahre.
Quellenkritik
Fazit
Die Wettergeschichte Mitteleuropas zeigt eine Abfolge von extremen Ereignissen, die oft mit klimatischen Schwankungen wie dem Mittelalterlichen Klimaoptimum oder der Kleinen Eiszeit zusammenhängen. Der Sommer 1540 sticht als die schwerste Hitzewelle und Dürre heraus, während kalte Winter wie 1739/40 und 1962/63 sowie regionale Schneerekorde wie 1988, 2010 oder 2013 die Variabilität des Klimas verdeutlichen. Derzeit bewegen wir uns in einer wärmeren Zeit nach der Kleinen Eiszeit mit insgesamt ansteigender Welt-Durchschnitts-Temperatur. Das habe ich bereits in meiner Diplom-Arbeit mit dem Vergleich von Luftmassenhäufigkeiten in Europa in den 1980igern und 1990igern gezeigt. Daher sind warme Sommer und milde Winter zunächst einmal auch in Mitteleuropa wahrscheinlicher. Allerdings zeigt diese Auflistung, dass jederzeit auch ein (überraschend) kalter Sommer oder strenger Winter möglich ist. Die Serie von mäßig kalten Wintern 2008/09 bis 2012/13 hat uns dies vor Augen geführt. Nach 2012/13 gab es eine Reihe von milden Wintern, daher ist (Stand 2025) es nur eine Frage der Zeit, bis uns auch in Mitteleuropa wieder ein grimmiger Winter oder verregnet-kühler Sommer heimsucht.
Die chronologische Auflistung ist ein Versuch, so nahe wie irgend möglich an die historische Realität heranzukommen. KI-Tools helfen heutzutage sehr dabei historische Quellen schnell zu finden und sie rasch auszuwerten. Mir ist aber stets wichtig, auch möglichst viele primäre oder sekundäre Quellen für die eigene Recherche zur Verfügung zu stellen. Das ist gerade bei den Zusammenfassungen der extremsten Ereignisse der Fall. Vielleicht kommt ein Leser dieser Auflistung an der einen oder anderen Stelle zu einer anderen Einschätzung.
Auch wenn 2000 Jahre für uns ein sehr langer Zeitraum erscheinen, ist es erdgeschichtlich nicht einmal ein Wimpernschlag. Historisch betrachtet war die Erde übrigens die meiste Zeit (fast) eisfrei und das andere Extrem war „kurzzeitig“ eine komplette Vereisung, hier mehr zur „Schneeball-Erde„.
Grundsätzlich wird das Klima der Erde von mehreren Faktoren beeinflusst:
Die genannten Faktoren interagieren komplex und wirken auf unterschiedlichen Zeitskalen, von Jahrzehnten bis Jahrtausenden. Ein größerer Vulkanausbruch oder eine Abschwächung des Golfstromes können beispielsweise für deutlich kältere Jahre in Europa sorgen. Die kältesten Sommer in der obigen Auflistung waren fast immer Folge von größeren Vulkaneruptionen.
Diese Abhandlung „Außergewöhnliche Wetterereignisse in Mitteleuropa“ wird fortlaufend aktualisiert und bei neuen Erkenntnissen möglicherweise auch modizifiert.
Falls die Seite gefallen oder weitergeholfen hat, freue ich mich über eine kleine Spende.


